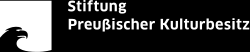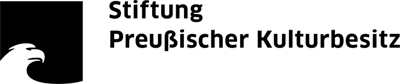Bereichsnavigation
Willkommen in der „Vorhölle“
News from 02/08/2016
Am „Tag der Archive“ (6. März 2016) öffnet mit dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz das Gedächtnis des untergegangenen Preußens seine Pforten. Dieses Mal geht es um „Mobilität im Wandel“. Wir sprachen vorab mit Prof. Dr. Jürgen Kloosterhuis, dem Direktor des GStA PK über den Auftrag seines Archivs, böse Preußen und die Einwanderungspolitik in Brandenburg-Preußen im 17. Jahrhundert.

Preußen, ein offenes Land
Am bundesweiten Tag der Archive (6. März 2016) öffnet das Gedächtnis Brandenburg-Preußens seine Türen unter dem Motto „Mobilität im Wandel der Zeit“. Dabei dienen die Schätze des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz als Material für Lesungen – und vor allem der Betrachtung der Vergangenheit mit Blick auf die Gegenwart: Ist doch unter anderem die Einwanderungspolitik in Preußen Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts Thema – und zwar als bewusst gesetzter Akzent vor dem aktuellen Hintergrund des Zustroms von Flüchtlingen und des Umgangs mit dieser Herausforderung, so Prof. Dr. Jürgen Kloosterhuis, Direktor des Geheimen Staatsarchivs. Es gehe darum, durch dieses Angebot die Besucher auch mal mit solchen Aspekten zu konfrontieren und zu zeigen, dass so neu das Problem nicht sei. „Aber ganz bestimmt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und nach dem Motto ‚So wie es der Alte Fritz gemacht hat, sollte Frau Merkel es auch machen‘.“
Ende des 17. Jahrhunderts kam eine ganze Reihe Glaubensflüchtlinge nach Brandenburg-Preußen, weil hier das „cuius regio, eius religio“ – nach dem der Landesherr bestimmen durfte, was man in seinem Lande zu glauben hatte – relativ locker gehandhabt wurde. „Es stellte in Preußen kein Thema dar, wenn Böhmische Brüder, hugenottische „Réfugies“ oder Salzburger kamen. Preußen war ein offenes Land für Zuwanderung“ erläutert Kloosterhuis die Hintergründe. Natürlich habe diese tolerante Bevölkerungspolitik wirtschaftliche Gründe gehabt, aber das sei ja nicht unziemlich, meint Kloosterhuis. Schließlich sei Preußen ja nicht die Heilsarmee gewesen.
Und dann haben sich auch damals Fragen à la „Wie kommt man nach Preußen? Welche Vermögen dürfen mitgenommen werden? Wie ist es mit dem Familiennachzug?“ gestellt. „Natürlich sind heute und damals zwei verschiedene Dinge, aber manches kommt einem bekannt vor. Heutzutage sind es andere Probleme, aber eine rückschauende Betrachtung kann lehrreich sein, weil man sich vor Augen führen kann, dass solche Probleme existierten, und dass man versuchen musste, sie zu lösen und das – wenn natürlich nicht reibungslos – auch geschafft hat“, erklärt Kloosterhuis.
Mobile Preußen
Vor allem geht es in den von Dr. Ingrid Männl konzipierten Lesungen am „Tag der Archive“ am 6. März 2016 aber um die verschiedenen Arten der Mobilität, zu denen sich in den Tiefen des Geheimen Staatsarchivs reichhaltige Quellen finden lassen. Angefangen im Mittelalter, bei den Urkunden und Kostenabrechnungen von 1316 die von der Reiseherrschaft des Markgrafen zeugen. Bevor dieser im Berliner Stadtschloss sesshaft wurde, übte er die Macht in seinem Territorium durch persönliche Anwesenheit vor Ort aus. Zudem gibt es Berichte von Bord der kurfürstlichen Flotte, die 1680 zur Afrika-Expedition aufbrach, und ebenjene Zeugnisse der Salzburger Glaubensflüchtlinge.
In einer weiteren Lesung geht es um die Zeit nach der Industrialisierung, die von technischen Neuerungen geprägt war: Es wird aus einem Zeitungsbericht zur Einführung der Eisenbahnlinie Berlin – Potsdam 1838 gelesen; ebenso aus Berichten zum Zeppelinflug über Berlin oder aus einem Reisebericht von einer Zeppelinreise nach Brasilien 1935, der die Reisezeit nach Lateinamerika von einigen Wochen auf wenige Tage verkürzte.
Wie es war, im Jahr 1881 nach Amerika auf dem Zwischendeck eines Dampfschiffs auszuwandern, kommt dank eines persönlichen Briefs zur Sprache („Schreckliche Überfahrt mit Essen wie Schweinefutter“). Wer mehr davon hören will: Die Dahlemer Archivarinnen und Archivare bieten am Tag der Archive an, sich den Schwierigkeiten privater Provenienzen – wie z.B. ungeübten Schreiberhänden oder fehlenden Vergleichsmöglichkeiten ihrer Buchstabenfolge – zu stellen und die mitgebrachten historischen Briefe der Besucher – beispielsweise von ausgewanderten Verwandten – zu entziffern, vorzulesen und zu diskutieren.
In der dritten Lesung geht es um die mobilen Preußen in der Welt: Im Geheimen Staatsarchiv finden sich Archivalien zur Lepsius-Expedition nach Ägypten 1842-45, die durch Unterstützung Alexander von Humboldts zustande kam, dessen Handschrift dann auch in den Akten zu finden ist. Vorgelesen werden zudem Berichte Le Coqs, der auf seinen Turfan-Expeditionen die Seidenstraße bereiste und es wird von der Expedition zum Tendaguru in Tansania 1913 berichtet, die als erfolgreichste Dinosauriergrabung gilt.
Außerdem gibt es einen Vortrag von Christiane Brandt-Salloum, der aufsehenerregende Bilder von „Mobilen Erfindungen“ zeigt. Bei Führungen durchs Archiv, durch die Ausstellung zum 1. Weltkrieg und die Dienstbibliothek können interessierte Laien u.a. erfahren, wie man das Geheime Staatsarchiv überhaupt benutzt. Und auch für die jüngste Generation ist gesorgt: Für Kinder gibt es am Tag der Archive Wappen- bzw. Stammbaummalen und Briefesiegeln.
Böses Preußen – Gutes Preußen
Auch mit dieser Veranstaltung wird das Geheime Staatsarchiv seinem „Sonderauftrag der preußischen Erinnerungskultur“, wie Prof. Kloosterhuis es nennt, gerecht, den das Haus für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz übernimmt. Es sei eine nicht immer einfache Aufgabe, etwas kritisch in Erinnerung zu halten, das zumindest nach dem 2. Weltkrieg als „böse“ stigmatisiert wurde, wie Kloosterhuis weiter ausführt. Die Aufgabe seines Hauses, zu einer historisch-kulturellen Erinnerungskultur beizutragen, reiche in politische Dimensionen: „Dieses Haus hat schon einen Legitimierungszwang mit der preußischen Geschichte. Das Geheime Staatsarchiv ist eine Stätte, die sich nicht aufdrängen darf. Wir haben hier keine Intention Preußenpropaganda zu betreiben“, beschreibt der Direktor weiter. „Wer Preußen mit seiner Erinnerungskultur bedient, muss sich den Fragen nach den ‚bösen‘ oder ‚guten‘ Preußen zumindest stellen –- und im besten Fall sie sich auch selber stellen. Für uns ist das doch hier fast das Paradies auf Erden, mit unseren schönen Akten. Aber knapp hinter dem Gartenzaun gibt es Leute, die unter Preußen eine Art Vorhölle verstehen. Nach wie vor.“
Aufgezeichnet von Gesine Bahr-Reisinger