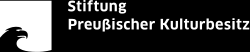Das Rätsel um die Kontrafagott-Stelle im vierten Satz der Neunten
News from 03/16/2020
We apologize that this content is available in German only.
Im Musikinstrumenten-Museum gibt es dank spezieller Interpretationsforschung den Komponisten am ursprünglichsten zu hören: Ein Gespräch mit Direktorin Conny Restle über den raueren, heiseren Beethoven

Das Corona-Virus hat auch dem Musikinstrumenten-Museum einen Strich durch das Programm im Beethoven-Jahr gemacht. Eine Vielfalt von Projekten und Veranstaltungen war vorbereitet, die jetzt erstmal auf Eis gelegt werden. Und dennoch: Das Programm „B and Me“ sollte an die große Ausstellung „Diesen Kuss der ganzen Welt“ in der Staatsbibliothek anschließen, die wegen der Corona-Krise derzeit leider nicht zu sehen ist. Es ist zum größten Teil ein bewusst niedrigschwelliges Angebot, das auch Kinder, Jugendliche und Menschen erreichen soll, die keine Spezialisten sind. Im Zentrum steht die Idee, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Die Interpretationsforschung geht freilich weiter. Darüber sprach Julia Spinola mit der Direktorin des Musikinstrumenten-Museums, Conny Restle.
Kann man überhaupt noch etwas Neues entdecken bei Beethoven, der doch schon sehr gut erforscht ist?
Gerade im Bereich der Interpretationsforschung gibt es noch sehr viel zu tun. Zum Beispiel wäre es sehr interessant, einmal die lange Beethoven-Tradition, die über Czerny und Liszt reicht, systematisch aufzuarbeiten. Für mich als Instrumentenkundlerin ist das Thema „Beethoven und die Instrumente“ sehr spannend, das sowohl für die Interpretationsforschung als auch für editorische Fragen wichtig ist. Die Kollegen von der neuen Beethoven-Gesamtausgabe sind zum Beispiel an mich herangetreten wegen einer fraglichen Kontrafagott-Stelle im 4. Satz der 9. Symphonie. Das Kontrafagott um 1820 verfügt nicht über den tiefsten Ton des normalen Fagotts. Meist reichte der Tonumfang des Kontrafagotts damals nur bis D oder C. Im Erstdruck wird diese Stelle daher oktaviert. Im Autograph wird die Stelle nach unten aber voll ausgeschrieben bis zum B1. Aufschluss geben hier zwei aus der Beethovenzeit erhaltene Instrumente, bei denen sich ein spezieller Aufsatz auf das Schallstück stecken ließ, mit dem dieser Ton erreicht werden konnte. Aber auch im Bereich der Kammermusik ist es sehr wichtig, danach zu fragen, mit wem Beethoven damals zusammengespielt hat und auf welchen Instrumenten.
Daniel Barenboim sagte kürzlich, die Klaviersonaten und die Streichquartette seien jene Gattungen, die für Beethoven wie eine Art „Tagebuch“ funktioniert hätten. Hier habe er sich am offensten und direktesten ausgedrückt. Teilen Sie diese Ansicht?
Das kann ich voll und ganz unterschreiben. Diese Gattungen waren ihm auch als ausübender Musiker am nächsten. Beethoven war ein unglaublicher Virtuose auf dem Klavier. Streichinstrumente beherrschte er auch, er hat in seiner Jugend als Bratscher in der Bonner Hofkapelle gespielt. Später in Wien hat er seine Streichquartette mit dem Schuppanzigh Quartett erarbeitet, gespielt und diskutiert. Das fand alles bei ihm zuhause statt. Es war eine Art Labor.
Am 10. Mai soll – wenn es Corona zulässt – das neue Schuppanzigh-Quartett im Musikinstrumenten-Museum ein sehr besonderes Konzert auf Originalinstrumenten aus Beethovens Besitz geben.
Wir haben das Quartett dieser Instrumente von der Königlichen Bibliothek 1888 zur Eröffnung unserer Sammlung vom Preußischen Königshaus erhalten, und es ist unglaublich spannend, originale Instrumente von Beethoven spielen und hören zu können. Beethoven hat sie von Karl Lichnowsky, einem seiner ersten Förderer, geschenkt bekommen, sicher im Hinblick darauf, dass das Schuppanzigh Quartett bei ihm im Hause proben kann. Wie wir heute wissen, sind diese Instrumente eigens umgebaut worden, bevor Beethoven sie erhielt. In der Zeit um 1800 wurden die meisten Streichinstrumente modernisiert. Die Halslage wurde steiler gestellt, die Mensur ist ein bisschen verändert worden – dadurch versuchte man damals, die Instrumente lauter zu machen und das virtuose Spiel zu erleichtern. Das Cello wurde von der Größe eines Continuoinstruments auf jene eines Soloinstruments verkleinert. Die Instrumente geben ein lebendiges Zeugnis, man rückt ganz nah an Beethoven heran. Um sie zur ursprünglichen Klangpracht zu führen, sollten sie gespielt werden. Das neue Schuppanzigh Quartett, das bei uns das Konzert gibt, probt schon seit geraumer Zeit auf ihnen.
Wie klingen diese Instrumente im Unterschied zu den modernen Instrumenten?
Dadurch, dass die Besaitung sehr nah an der ursprünglichen Darmbesaitung ist, klingen die Instrumente etwas rauher im Ton, sie sprechen ein bisschen „heiserer“ an. Was die Intonation betrifft, zwingen sie die Musiker, viel genauer auf einander zu hören, sich aufeinander und auf ihr Instrument einzulassen. Die musikalischen und spieltechnischen Fähigkeiten der damaligen Musiker müssen enorm gewesen sein, sonst hätten sie diese komplizierte Musik auf diesen Instrumenten nicht zum Klingen bringen können. Wir denken in unserem Fortschrittsglauben immer, dass mit der Zeit alles besser und perfekter wurde. Ich meine eher, dass die künstlerische Qualität des Instrumentalspiels im Laufe der Zeit in mancherlei Hinsicht auch wieder abgenommen hat. Heute werden auch die alten Instrumente optimiert, indem man etwa versucht beim Cello den sogenannten Wolfton, bei dem die Grundfrequenz auf die Eigenschwingung des Korpus trifft, herauszubekommen. Wir können jetzt erfahren, wie die Streichquartette möglicherweise zu Beethovens Zeit geklungen haben. Es ist natürlich nur eine Annäherung, denn wir hören heute anders und sind anders sozialisiert. Eine absolut authentische Konzertsituation kann man nicht herstellen. Aber die Unterschiede sind sehr groß. So gab es auch völlig andere Fingersätze damals und eine andere Bogenführung. Man hat stärker phrasiert, während man heute alles mit einem großen Legato spielt, das den Ton insgesamt runder und voller macht. Damals ging es stärker um das Sprechen, das Herausarbeiten der Struktur eines Stückes. Und das funktioniert auf den alten Instrumenten viel besser, man muss auf ihnen ganz stark ins Detail eines Stückes gehen. Dadurch hört man plötzlich Stellen, über die sonst hinweggespielt wird. Ähnlich ist es auch bei den alten Tasteninstrumenten: man muss sich auf diesen Instrumenten intensiver mit den Stücken beschäftigen, um ein passables Ergebnis zu erzielen.
Wie hat der Instrumentenbau im Bereich der Klaviermusik Beethovens Werke beeinflusst?
Beethoven hat als ein begnadeter Pianist, der keine besondere Ausbildung genossen hatte, zwei bis drei Generationen Klavierbau miterlebt und mitgestaltet. Bis er nach Wien kam, spielte er das Cembalo, dass besonders an den Fürstenhöfen als Generalbassinstrument noch eine große Rolle spielte. Überliefert ist, dass er einmal auf einem Tangentenflügel von Späth und Schmahl gespielt hat, mit dem er wohl nicht sehr glücklich war. In Wien befand sich Beethoven dann im Zentrum des europäischen Klavierbaus. Wir wissen, dass er auf den Wiener Instrumenten gespielt hat, aber keins besaß. Denn er wartete wohl darauf, dass der berühmteste Wiener Klavierbauer, Anton Walter, ihm ein Instrument schenken würde – was nicht geschah. Da Beethoven aber sowieso in den Adelskreisen als Virtuose weitergereicht wurde und von Abend zu Abend weiterzog, wo er die besten Instrumente spielte, begnügte er sich für das häusliche Klavier mit Kurzleihgaben. Bis zur Klaviersonate op. 27, 2, der „Mondscheinsonate“, kann man alle seine Sonaten auf diesen kleinen Instrumenten von Walter spielen. Das waren Instrumente, bei denen sich die Dämpfung mit einem Kniehebel aufheben ließen, beinahe wie bei einem Orgelregister. Dann aber geschieht es, dass Beethoven - zum einzigen Mal in seinem Leben - selbst ein Instrument bestellt und bezahlt: Er kauft sich einen Flügel von Sébastien Érard aus Paris.
Am 17. Mai soll der Pianist und Musikforscher Tom Beghin im Musikinstrumenten Museum auf einem Nachbau dieses Érard-Flügels aus der Werkstatt von Chris Maene spielen. Was ist das Besondere an diesem Instrument?
Das Original befindet sich heute im Landesmuseum in Linz, aber es ist leider verändert worden. Mit einem Nachbau kommt man interessanterweise viel näher an den Originalklang heran. Der Érard hat eine völlig andere Mechanik als die Wiener Instrumente, eine sogenannte Stoßmechanik, die es erlaubt, wesentlich mehr Energie in das Instrument zu bringen, vor allem im Bassregister. Ich bin überzeugt davon, dass Beethoven diesen Érard-Flügel sehr geschätzt hat, gerade auch vor dem Hintergrund seiner zunehmenden Taubheit. Der Flügel hat einen größeren Umfang von 5 ½ Oktvaen bis zum viergestrichenen c – und den brauchte Beethoven damals für seine „Waldsteinsonate“. Als sein Gehör weiterhin schlechter wurde, hat er ein noch größeres, englisches Instrument bekommen mit einem Umfang von 6 Oktaven, das ebenfalls eine Stoßmechanik hatte. Beethoven versuchte, mithilfe eines Stabes, der mit seinem Kiefer verbunden war, die Musik über Resonanzen wahrzunehmen. Für dieses Instrument entstand die Große Hammerklaviersonate. Wichtig für ihn war auch, dass man auf diesen Instrumenten den gesamten Ambitus des Orchesters wiedergeben konnte, vom Kontrafagott bis zur Piccoloflöte. Der alte Érard-Flügel hat viel mehr Obertöne als der moderne Konzertflügel, auch im relativ tiefen Bereich. Man kann wesentlich schneller darauf spielen und man kann mehr dynamische Zwischennuancen erzielen. Diese historischen Instrumente haben auch sehr verschiedene Klangfarben in den verschiedenen Registern. Heute versucht man, die Flügel so zu bauen und einzustellen, dass sie über den gesamten Klaviaturumfang möglichst gleichmäßig klingen. Das war damals aber gar nicht erwünscht. Das tiefe Register sollte möglichst wie Streicher oder wie ein Fagott klingen, der mittlere Bereich wie die Klarinetten und der hohe Bereich wie Posaunen oder Trompeten. Nicht nur vom Ambitus her, sondern auch in Bezug auf die Klangfarbe wurde das Klavier zum Orchesterersatz.
In Beethovens späten Sonaten spielt sich die Musik hauptsächlich in den Extremen ab, im Bass- und im Diskantbereich.
Genau, und man kann davon ausgehen, dass sie damals noch viel kontrastreicher klang, als auf unseren modernen Instrumenten. Beethoven ist in diesen Werken ganz bewusst an die Grenzen gegangen. Er kannte die Instrumente perfekt und wusste genau, wie man sie behandeln muss.
Weiterführende Links
- Interview mit Mireya Salinas und Conny Restle zum Vermittlungsprogramm „B and Me“
- Website des Staatlichen Instituts für Musikforschung mit aktuellen Informationen