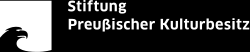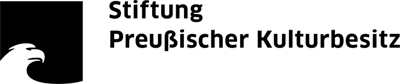Neues von den Hohenzollern: So lebte die „wilde“ Glienicker-Linie
News vom 21.09.2016
Einzigartige Einblicke ins Leben einer unkonventionellen Familie gewährt der Teilnachlass des Prinzen Friedrich Leopold jr. von Preußen. Archivarin Anke Klare verrät, welche Perlen die Dokumente für die Forschung bereithalten.

Das Geheime Staatsarchiv PK hat einen Teilnachlass des Prinzen Friedrich Leopold junior von Preußen (1895-1965) mit nahezu 500 Schreiben erworben. Es handelt sich um die private Korrespondenz der Prinz Carl- oder Glienicker-Linie des preußischen Königshauses, die von dem dritten Sohn Friedrich Wilhelms III., Prinz Carl (1801-1883), begründet wurde. Für die inhaltliche Erschließung der umfangreichen Neuerwerbung ist die Archivarin Anke Klare zuständig, deren Urgroßmutter am Hof der Hohenzollern in Glienicke diente.
Frau Klare, Prinz Friedrich Leopold von Preußen war Ihnen als Person schon bekannt, bevor Sie im Geheimen Staatsarchiv arbeiteten. Aus welchem Zusammenhang?
Ich kannte die prinzliche Familie schon durch die Erzählungen meiner Uroma und meiner Oma, da meine Uroma Margarethe Krüger, geborene Griesbach, von 1902 bis 1912 als Garderobenfrau von Prinzessin Friedrich Leopold senior, also der Mutter des Nachlassers, tätig war.
Welches Bild hat sich Ihnen aus den Erzählungen über den Glienicker Hof vermittelt?
Die Familie in Glienicke wurde immer als freundlich, respektvoll und großzügig beschrieben, aber auch als sehr unkonventionell und weniger reglementiert in ihrem Hofleben, was ja immer wieder zu Schwierigkeiten mit dem Kaiser führte und Aufsehen in der Öffentlichkeit erregte.
Welchen von den 500 Briefen haben Sie als ersten zum Lesen in die Hand genommen?
Ich habe tatsächlich mit den Briefen, die obenauf lagen, begonnen und dabei gleich eine schöne Entdeckung gemacht. Mir fiel ein Brief von Luise Margarethe von Preußen (nach der Heirat von Großbritannien) in die Hände, den sie als Mädchen ihrem Großvater, dem Prinzen Carl, zum Geburtstag schickte. Sie legte ein vierblättriges Kleeblatt bei, das ihr kleiner Bruder Friedrich Leopold senior in Klein-Glienicke auf dem Böttcherberg gefunden hatte.
Haben Sie den Eindruck, dass es auch von der Forschung noch interessantes Material zu Prinz Carl zu entdecken gibt?
Auf jeden Fall. Ich denke, wir haben hier eine richtige Fundgrube vor uns. Besonders viel versprechend erscheint mir ein relativ geschlossenes Konvolut für die Zeit 1858 bis 1865, das wir neben den Briefen auch noch angekauft haben. Es enthält die eigenhändigen Mitteilungen des Hofstaatssekretärs des Prinzen Carl, Herrn Bachmann, der nahezu täglich aus dem Berliner Palais am Wilhelmsplatz an einen Hofbeamten in Glienicke schreibt. In diesen Aufzeichnungen finden sich interessante Details zur Herrichtung des für den Sohn Friedrich Karl erworbenen Jagdschlosses in Klein-Glienicke, wie zum Beispiel Hinweise auf die Stuhlbespannung oder den Umbau von Schweizer Häusern. Außerdem gibt das Konvolut interessante Einblicke in das Berliner Hofleben des Prinzen Carl, wie zum Beispiel über die Feste oder die Theaterbesuche.
Aus dem Besitz ihrer Uroma stammt die Fotografie von Prinzessin Louise Sophie und Prinz Friedrich Leopold junior, die 1911 in England aufgenommen wurde. Sie zeugt von einem besonders innigen Verhältnis zwischen Mutter und Sohn. Bestätigen die Briefe den Eindruck?
Ja, unbedingt. Schon allein die Anreden in den Briefen sind sehr liebevoll, teilweise auch mit Kosenamen bis ins Erwachsenenalter vorkommend. Die Mutter schreibt beispielsweise an ihren Sohn „mein liebes süßes Kindchen“ oder benutzt auch das englische Wort „darling“ und hofft immer auf ein baldiges Wiedersehen. Der Sohn redet seine Mutter an mit „meine liebste Mami“ und beendet den Brief meistens „mit innigen Küssen, dein Baby“. Er war ja das jüngste der vier Kinder und im Unterschied zu seinen beiden älteren Brüdern, die in der militärischen Tradition der Familie standen, sehr sensibel, künstlerisch interessiert und auch begabt. Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn wird dann in späterer Zeit noch enger, da die älteren Kinder schon in jüngeren Jahren starben und der Tod des Ehemanns bereits 1931 erfolgte, so dass von der Familie nur noch sie beide übrig blieben.
1939 erschienen in England unter dem Titel „Behind the scenes at the Prussian court“ die Memoiren der Prinzessin Louise Sophie. Darin kommt ihr angespanntes Verhältnis zu Kaiser Wilhelm II. als dem Oberhaupt der preußischen Königsfamilie an mehreren Stellen zum Ausdruck. Finden sich entsprechende Äußerungen auch in den Briefen?
Es ist ja bekannt, dass der Kaiser über die Glienicker Prinzenfamilie wegen ihres unkonventionellen und verschwenderischen Lebensstils 1895 vierzehn Tag Hausarrest verhängte und 1917 ein Entmündigungsverfahren gegen Friedrich Leopold junior aufgrund seiner luxuriösen Lebensführung in München anstrengte. Es gab noch einen weiteren Vorfall, der auch in den Memoiren erwähnt ist und auf den in einem Brief Bezug genommen wird. Offensichtlich schickte der Kaiser 1903 gegen den Willen des Prinzenpaares in Glienicke ihre zwei ältesten Söhne auf die Kadettenanstalt in Naumburg. Dazu äußerte sich Luise Margarethe von Großbritannien, die Schwester von Friedrich Leopold senior, in einem Brief an ihre Schwägerin Louise Sophie sehr betrübt: „daß Ihr nie auf freundschaftlichem Fuß mit Seiner Majestät leben könnt!! und daß man Euch immer Ärger bereitet“. Auch hofft sie, dass bald wieder Frieden in der Familie einkehren möge.
Mit der Niederlegung der deutschen Kaiserkrone durch Wilhelm II. fand 1918 auch die preußische Monarchie ihr Ende. Wie veränderte diese Zäsur das Leben der Prinzenfamilie in Glienicke?
Natürlich bedeutete das Ende der Monarchie einen tiefen und bleibenden Einschnitt. Die Familie floh aus Glienicke und ging über München, den Wohnsitz des Prinzen Friedrich Leopold junior seit 1917, und das Familiengut Imlau bei Salzburg nach Lugano in die Schweiz. Die nach 1918 erhaltene Abfindung reichte nicht aus, um den gewohnten Lebensstil aufrechtzuerhalten. Nach dem Tod des Vaters 1931 gingen sogar die zwei Villen am Luganer See verloren. Der Sohn Friedrich Leopold lebte danach bis zu seinem Tod auf Imlau, die Mutter Louise Sophie ging nach Klein-Glienicke zurück, konnte aber nicht mehr zurück ins Jagdschloss, sondern wohnte im sogenannten Haus Glienicke, einem ehemaligen Restaurant. In den Briefen werden die ständigen Geldsorgen und auch die Einsamkeit von Mutter und Sohn wiederholt thematisiert. Im Mai 1933, also kurz nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, berichtet Friedrich Leopold junior von Zerstörungen und Plünderungen am Schloss Glienicke, insbesondere am Casino, die er mit den Worten „sieht mir alles wie bestellte Arbeit aus!“ kommentiert.
Prinz Friedrich Leopold ist auch selbst ein Opfer des Nazi-Terrors geworden. 1944 wurde er im Konzentrationslager Dachau inhaftiert und von dort mit weiteren prominenten Häftlingen als SS-Geisel nach Südtirol verschleppt. Ende Mai 1945 erfolgte die Befreiung erst durch deutsche und dann durch amerikanische Soldaten. Werden diese tragischen Ereignisse in den Briefen erwähnt?
Bislang konnte ich keinen konkreten Hinweis auf das furchtbare Ereignis feststellen. Es findet sich jedoch eine Randbemerkung auf einem Brief der Mutter an ihren Sohn vom Januar 1950, in der sie auf den weiteren Werdegang des Theologen Martin Niemöller Bezug nimmt. Niemöller war ebenfalls ein prominenter Mithäftling von Friedrich Leopold junior in Dachau und stand in der Bundesrepublik wegen seiner Stellungnahme zu politischen Themen oft im öffentlichen Focus.
Worin liegt für Sie der besondere Reiz bei der Erschließung von privater Korrespondenz?
Im Gegensatz zu den amtlichen Verwaltungsakten gibt die private Korrespondenz Einblicke in die Gedanken und Gefühle der schreibenden Personen. Insbesondere gesellschaftliche Umbrüche werden dadurch anschaulicher erfahrbar. Im Fall des neu erworbenen Nachlasses sind vielleicht sogar neue Erkenntnisse über das Leben am Glienicker Hof zu erwarten.
Das Interview führte Ingrid Männl
Weiterführender Link