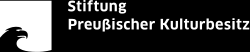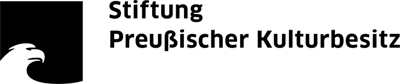Rede des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Klaus-Dieter Lehmann anlässlich der Verleihung des Felix Mendelssohn Bartholdy-Preises 2007 am 14. Januar 2007
Pressemitteilung vom 14.01.2007
Anrede,
Die Förderung außergewöhnlich begabter, fortgeschrittener Studierender der Musikhochschulen in Deutschland durch die Verleihung des Felix Mendelssohn Bartholdy-Preises in Berlin ist in jedem Jahr ein herausragendes Ereignis.
Der Preis hat mit seiner Begründung 1878 eine traditionsreiche Geschichte und eine lebendig gebliebene öffentliche Anerkennung. Seine Anerkennung beruht nicht zuletzt auf dem Renommee der bisherigen Preisträger, dem Prestige der verleihenden Institution, der objektiven Expertise der Jury und der Originalität der Zielsetzung.
Hinzu kommen als objektive Preiskonditionen neben dem finanziellen Preis öffentliche Konzerte, zum einen das heutige Preisträgerkonzert, zum anderen Folgekonzerte im Zusammenhang mit dem „Kammermusikpreis der Freunde Junger Musiker Deutschland“ in verschiedenen Städten.
23 Musikhochschulen Deutschlands beteiligen sich, die Rektorenkonferenz führt den Wettbewerb durch, unter Einbeziehung ausgewiesener Fachjuroren. Jedes Jahr ist ein besonderes Jahr. Jedes Jahr erleben wir in der getroffenen Auswahl qualitätvolle und eindrucksvolle junge Musikerinnen und Musiker am Anfang ihrer künstlerischen Laufbahn, für uns ein Geschenk, für die jungen Talente eine Chance. Über all die Jahre galt immer das gleiche grundlegende Motiv: Es sollte eine direkte Förderung junger, noch in der Ausbildung befindlicher Musikerinnen und Musiker sein. Entscheidend sind das direkte Messen im Wettbewerb und die Auslese unter den Besten.
Bundespräsident Köhler weist zu Recht in seinem Grußwort zum Felix Mendelssohn Bartholdy-Preis darauf hin, dass Spitzentalente nicht vom Himmel fallen, sondern deshalb Spitze sind, weil es eine breite Basis gibt. Und er sagt weiter: „Diese Grundlage kann allein eine gute allgemeine musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche schaffen. Das ist wichtig für jeden Menschen, und es ist wichtig für unser Zusammenleben, denn Musik hat auch im übertragenen Sinn viel mit Harmonie und Kreativität zu tun. Darum wird überall, wo mit ansteckender Freude Musik gemacht wird – in Kindergärten, Schulen, Musikschulen, Chören, Bands, Vereinen – ein unverzichtbarer Beitrag für uns alle geleistet.“
Das ist eine eminent wichtige politische Aussage. Denn wir haben in den letzten Jahren erlebt, wie drastisch die musische Erziehung u.a. im Schulunterricht zurückgedrängt worden ist. Genau diese notwendige Breite des Musikunterrichts, die Konsequenz in früher Zeit einzusetzen und dabei zu bleiben, haben wir uns genommen. Die deutschen Musikhochschulen sind dagegen nach wie vor weltweit wegen ihrer Qualität gefragt. So nimmt es nicht Wunder, dass vermehrt ausländische Studierende ausgebildet werden. Ein Preis wie der Felix Mendelssohn Bartholdy-Preis, ist deshalb ein zutiefst kulturpolitischer Preis. Er zeichnet die Besten aus, nicht die besten Deutschen. Das jeweilige Ergebnis ist vielleicht so etwas wie eine Tendenzaussage über den Stellenwert musikalischer Erziehung und Wertschätzung der praktizierten Musik in einer Gesellschaft.
Interessant ist auch, dass der Bundespräsident in diesem Zusammenhang dem zivilgesellschaftlichen Engagement eine wichtige Rolle beimisst. Und zwar in doppelter Funktion: als Laienorganisationen in den verschiedensten künstlerischen Sparten und als Trägerverein, Ehrenamt, Sponsoren oder Mäzene.
Stärkung des Bürgerschaftlichen Engagements kann eine positive Entwicklung für das Musikleben bedeuten, denn es bietet nicht nur Fördermöglichkeiten durch alternative Finanzierungsformen, sondern erreicht durch persönlichen Einsatz und persönliches Handeln eine intensivere Verbundenheit und Lebendigkeit. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten zu sehr daran gewöhnt, dass der Staat alles richtet.
Dieses Thema hat durchaus mit dem Felix Mendelssohn-Bartholdy-Preis zu tun, war es doch eine bürgerschaftliche Tat, die am Anfang des Preises 1878 stand. Die Erben des Generalmusikdirektors Felix Mendelssohn-Bartholdy überließen dem Staat Preußen die Musikhandschriften und den Nachlass, Preußen wiederum erklärte sich bereit, den musikalischen Nachwuchs durch Stipendien bzw. einen jährlichen Wettbewerb zu fördern.
Der gesamte Nachlass befindet sich heute in der Staatsbibliothek zu Berlin, einer Einrichtung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Familie Mendelssohn hat vom 18. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert bedeutende kulturelle und wirtschaftliche Persönlichkeiten hervorgebracht. Sie waren darüber hinaus herausragende Mäzene im kulturellen, wissenschaftlichen und sozialen Bereich. Im 19. Jahrhundert setzte in Deutschland, bevorzugt in Preußen, eine dynamische Bildungsoffensive ein, getragen von einer sich allmählich emanzipierenden Bürgerschaft, nicht immer ohne Spannung mit der Obrigkeit. Vor dem Hintergrund der gewaltigen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Veränderungen, besonders in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts, bildete sich ein großbürgerliches Mäzenatentum heraus, das sich im Aufschwung des kommunalen Stiftungswesens der Kunst- und Wissenschaftsförderung widerspiegelte. Dabei war das Engagement jüdischer Mäzene für Kunst und Kultur überproportional hoch. Obwohl die jüdische Bevölkerung vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges nur 4,3 Prozent der Einwohner Berlins ausmachte, stammten knapp 38 Prozent des von der Stadt verwalteten Stiftungsvermögens aus jüdischem Besitz. Berlin hatte aber nicht nur die Sonderstellung bei den jüdischen Wirtschaftseliten, sondern auch bei den jüdischen Kultureliten.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zerbrachen die Grundlagen für bürgerschaftliches mäzenatisches Engagement. Auch die Verleihung des Felix Mendelssohn Bartholdy-Preises musste während der NS-Zeit eingestellt werden. Heute, im vereinten Deutschland, beginnt wieder deutlicher zivilgesellschaftliches Handeln zu greifen. Die Bürgerstiftungen haben Zulauf, Selbsthilfe organisiert sich. Was aber Not tut, sind ein stärkerer Abbau bürokratischer Hemmnisse bei zivilgesellschaftlichen Initiativen und eine umfassende Reform des seit Jahrzehnten unsystematisch gewachsenen Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts, verbunden mit zusätzlichen steuerlichen Anreizen.
Es ist erfreulich zu erleben, dass der aus mäzenatischem Ursprung entstandene Felix Mendelssohn Bartholdy-Preis in unseren Tagen eine Art bürgerschaftliche Zustiftung erfahren hat. Mit der Entscheidung des Förderkreises „Freunde Junger Musiker“ in Berlin, Bremen, Kassel, Düsseldorf, Köln/Bonn, Frankfurt a.M., Mainz/Wiesbaden, München und Budapest, den dotierten Kammermusikpreis des Förderkreises den gleichen Qualitätsanforderungen und Verleihungsprozeduren zuzuordnen, wird ein erfreulich verstärkendes Element hinzugefügt.
Damit schließt sich nicht nur ein Kreis zivilgesellschaftlichen Engagements, sondern diese Entwicklung macht berechtigte Hoffnungen auf ein Zusammenspiel von Staat, Fachleuten und Mäzenen zur produktiven Förderung junger künstlerischer Talente. Damit wäre viel gewonnen - nicht nur Geld, sondern auch Wertschätzung und Erlebnisfreude.