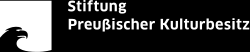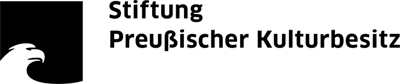Europas neue Alte: „Nicht alt, nur schon ziemlich lang am Leben“
News vom 29.04.2016
Wie fühlt sich Altsein heute an? Und was macht man, wenn der Lebensabend eigentlich schon am Spätnachmittag beginnt? Um das herauszufinden sind Irene Ziehe und Gabriele Kostas über zwei Jahre mit Kamera und Diktiergerät durch Europa gereist. Die Ergebnisse sind ab dem 29. April 2016 im Museum Europäischer Kulturen zu sehen.

Wann immer er den Motor startet, den Helm festzurrt und sich den Fahrtwind entgegenschlagen lässt, ist Ingemar zufrieden. Er brauche das, um sich frei und unbeschwert zu fühlen, verrät er Gabriele Kostas, der Fotografin, die ihn später auf seinem Motorrad abbilden wird. Ingemar ist 74, Schwede, und denkt überhaupt nicht daran, die schwarze Lederkluft gegen Strickjacke und Schaukelstuhl einzutauschen.
Ingemars Foto ist eines von Tausenden, die Kostas während des zweijährigen Projekts „Europas neue Alte“ geschossen hat. Zusammen mit Irene Ziehe, Kuratorin am Museum Europäischer Kulturen, hat sie den Lebensalltag alter Menschen in Europa dokumentiert, ihre Wünsche und ihr Selbstverständnis festgehalten. „Unsere Teilnehmer stammen unter anderem aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Georgien, Großbritannien, Italien, Österreich, Portugal, Russland, Slowenien und Spanien. Wir haben versucht, die verschiedensten Region abzudecken,“ beschreibt Irene Ziehe ihr Projekt, „aber natürlich auch verschiedene Milieus – urbanes Leben, Menschen auf dem Land, Intellektuelle, Handwerker, Bauern, Übersetzer, Männer, Frauen… Eine gute Mischung war uns wichtig.“ Das Projekt, das nun in eine Ausstellung mündet, ist Teil der Reihe „Europabilder“. Diese lotet die Ansichten aus, die Europa von sich selbst hat.
Dank neuer medizinischer Methoden und gewachsenem Wohlstand leben Menschen in vielen Regionen Europas länger als je zuvor. Das „Alter“ kann heute mehr als zwei Jahrzehnte dauern. Wie Ingemar – und viele weitere Europäern jenseits der 65 – diese Zeit empfinden, haben Ziehe und Kostas mit einem Fragebogen festgehalten: „‚Was essen Sie gern?‘, ‚Welche Kleidung bevorzugen Sie?‘, ‚Welche Pläne haben Sie?‘, ‚Was ist Ihnen besonders wichtig?‘, ‚Wohin reisen Sie gern und mit wem?‘ – Wir haben in unseren Fragen bewusst auf den Alltag abgezielt. Für einen tiefgreifenden Vergleich zu kulturellen Vorstellungen in den Gesellschaften der jeweiligen Länder war unsere Gruppe zu klein“, so Irene Ziehe. Die Teilnehmer unterscheiden nicht nur ihre unterschiedlichen Berufe, sondern auch die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in ihren Ländern, wie Ziehe betont: „In Schweden zum Beispiel muss man nicht unbedingt im Rentenalter arbeiten, um ein Auskommen zu haben. Das ist in Georgien schon eher der Fall, weil es andere Absicherungssysteme gibt. Wir hatten aber auch Teilnehmer dabei, etwa aus Italien, die ein eigenes Geschäft haben. Sie legten mit 65 nicht einfach die Arbeit nieder, obwohl es möglich wäre. Persönliche Leidenschaft und der Wunsch nach Betätigung spielen hier eine große Rolle. Wer in der Landwirtschaft arbeitet, hört auch erst auf, wenn er körperlich nicht mehr kann – oft aus wirtschaftlichen Gründen. Diese verschiedenen Leben erlauben einen äußerst vielfältigen Blick auf das Alter. Und in Fragen, die ihre grundlegendsten Bedürfnisse und Wünsche ansprachen, waren sie sich erstaunlich ähnlich – ganz unabhängig vom Standort.“ So ist für alle Befragten die Familie von größter Bedeutung. Auch bei der Bekleidung sind sich alle einig: bequem muss es sein, aber auch angemessen modern und dem Anlass entsprechend. Bei den Lieblingsspeisen ziehen die meisten ihre regionaltypische Hausmannskost vor – Hauptsache, sie ist von ihren Liebsten zubereitet.
Erstaunlich ist, dass die Lebensentwürfe der „Alten“ auch zu jüngeren Jahrgängen passen würden: Mit 64 Jahren entdeckte Ingemar das Motorradfahren für sich. Da war er fast acht Jahre geschieden. Heute pendelt er im zwei-Wochen-Takt zu seiner fast 250 km entfernten Lebensgefährtin, genießt es aber auch, viel Zeit allein zu verbringen. „Unsere Sprache schränkt die Vielfalt der Erfahrungen ein, die es gibt“, kommentiert Irene Ziehe die Labels, die für Lebensentwürfe jenseits der 60 existieren. „Wenn man sagt‚ ich fühle mich noch nicht alt‘ impliziert das meist, man ist noch nicht gebrechlich. Alt sein wird mit Verlust gleichgesetzt – der körperlichen Kraft, sozialer Kontakte, der Selbstständigkeit. Jung sein steht dagegen oft für positive Werte. Dieses Pendeln zwischen den Extremen passt aber nicht zu den Haltungen, die wir vorgefunden haben. Am markantesten war für mich, dass das Bild vom ‚fitten Rentner‘ kaum einem so richtig zusagte. Viele wollten Jugendlichkeit nicht hervorheben, zum Beispiel über die Wahl der Kleidung, aber auf der anderen Seite auch nicht den behäbigen Greis mimen. Stattdessen meinten die meisten, sie fühlten sich alterslos. Ein Befragter sagte mir: ‚Ich bin nicht alt, ich bin nur schon lange am Leben.‘ Das fasst es für mich perfekt zusammen.“
Die Ausstellung gewährt Einblicke in diese 27 höchst unterschiedlichen, ziemlich langen Leben. Dafür haben Kostas und Ziehe ihre Fotosammlung auf insgesamt 147 Bilder destilliert und um kurze Essays zu den einzelnen Personen ergänzt. Die Antwortzettel aus den Befragungen sind ebenfalls zu sehen. Einige Fragebögen wird man zudem leer in der Ausstellung vorfinden. „Wir lassen das Projekt bewusst offen. Die Fragen, die wir mit uns durch Europa getragen haben, kann sich während der Ausstellung jeder selbst stellen“, so Irene Ziehe. Dazu liegen im Museum Tablets aus, auf denen neue Bögen ausgefüllt werden können. Wer möchte, kann ebenfalls ein Foto von sich machen lassen und die Ausstellung so durch seine eigene Lebensgeschichte ergänzen. In einer Art „Werkstatt“ können sich zudem Menschen unterschiedlicher Generationen begegnen. „Wir verstehen das Museum Europäischer Kulturen als einen Ort, der das moderne Leben betrachtet, Menschen ins Gespräch kommen lässt und bestenfalls Schnittstellen erfahren hilft. Das Thema ‚Altern‘ ist da keine Ausnahme“, kommentiert Kuratorin Ziehe diesen partizipativen Ansatz.
Aufgezeichnet von Silvia Faulstich