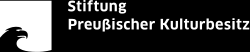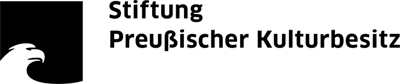Großes (Stummfilm-)Kino: Mighty Wurlitzer meets Marlene Dietrich
News vom 21.11.2016
Bis Februar 2017 zeigt das Musikinstrumenten-Museum jeden Monat eine Perle des Stummfilms – mit Livemusik. Wenn dabei also Marlene Dietrichs Schuhe klackern und Dr. Caligari schaurig schleicht, liegt das an der Mighty Wurlitzer-Orgel – der Klangmaschine des frühen Kinos. Organist Jörg Joachim Riehle erklärt im Gespräch die Renaissance der Kinoorgel in Berlin und warum er an der Wurlitzer immer Smoking trägt.

Donnergrollen und Vogelzwitschern, Sirenengeheul und Glockengeläut - die Klangpalette der Mighty Wurlitzer ist gewaltig. Die Theater- und Kinoorgel des Museums ist das größte Instrument seiner Art auf dem europäischen Kontinent. Gebaut hat sie 1929 ein Instrumentenbauer aus dem sächsischen Markneukirchen, der 1853 nach Amerika ausgewandert war und mit seiner Rudolph Wurlitzer Company zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum Erfinder und Weltmarkführer der Theaterorgel wurde.
Herr Riehle, wann haben Sie das erste Mal an der Mighty Wurlitzer des MiM gesessen?
Das war 1989. Da habe ich als freier Mitarbeiter im Musikinstrumenten-Museum angefangen. Von meinem Vorgänger Robert Ducksch habe ich die wöchentlichen Orgelkonzerte am Samstagvormittag um 12 Uhr übernommen, die seitdem regelmäßig stattfinden.
Wer kommt denn so zu den Konzerten?
Das waren früher vor allem sehr viele Orgelfans, aber auch viele Kinder. Heute ist das Publikum sehr gemischt, aber Kinder haben nach wie vor sehr viel Spaß an der Orgel. Das merke ich auch bei meinen Führungen mit Kita- und Schulklassen.
Das ist kein Wunder. Denn mit der Mighty Wurlitzer kann man einen ganzen Geräuschkosmos erzeugen. Da sind nicht nur die über 200 Register und mehr als 1200 Pfeifen, sondern auch noch ein Schlagwerk und jede Menge Geräuscheffekte.
Ja, man kann von Vogelgezwitscher bis Donnergrollen eine Unmenge an Geräuschen erzeugen, zusätzlich zu den einmalig vielen Klangmöglichkeiten, die die unterschiedlichen Register ermöglichen.
Die Orgel kam 1982 ins Berliner Musikinstrumenten-Museum. Wo stand sie vorher?
Sie stand in der Villa von Werner Ferdinand von Siemens in Lankwitz, dem Enkel des Firmengründers Werner von Siemens. Er war derart begeistert vom Klangzauber der Wurlitzer-Orgel, dass er 1928 nach North Tonawanda, New York, fuhr, um sich ein Instrument zu bestellen. Das kam am 28. Januar 1929 in Berlin an. Siemens verkaufte es allerdings gleich wieder an den Ufa Palast am Zoo, weil sich die Möglichkeit für ihn ergab, ein noch größeres Instrument zu erwerben. Das kam dann Ende August in Lankwitz an und wurde im Konzertsaal seiner Villa installiert.
In den 1920er Jahren gab es rund 25 Kinoorgeln in Berlin. Wo sind die alle geblieben?
Als 1930 Josef von Sternbergs Film „Der Blaue Engel“ mit Marlene Dietrich herausgekommen war, wollte eigentlich keiner mehr Stummfilme sehen. Jedes Kino musste einen Tonfilmprojektor kaufen, die Kinoorgeln wurden verkauft, manche auch verschrottet. Jene, die noch übrig waren, wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Das war’s dann. Die Kinoorgel im Kino Babylon hatte man eingemauert und dann quasi vergessen, so konnte sie die Zeit bis heute überstehen. Die Wurlitzer des Musikinstrumenten-Museums hat den Krieg in der Siemens-Villa überstanden. Schäden nach einem Kabelbrand wurden Dank eines amerikanischen Soldaten, der in Berlin stationiert war, behoben. 1982 wurde die Wurlitzer dann als „unentgeltliche Übereignung der Bundesrepublik Deutschland“ Bestandteil der Instrumentensammlung des MiM.
Stichwort: Marlene Dietrich. Im November ist ja eine neue Filmreihe im Musikinstrumenten-Museum gestartet, in der Sie im Wechsel mit Anna Vavilkina, der Organistin des Babylon, einmal im Monat einen Stummfilm begleiten. Als erstes stand am 23. November der Film „Die Frau, nach der man sich sehnt“ von 1929 auf dem Programm, in dem Marlene Dietrich – noch vor dem Blauen Engel – ihre erste Hauptrolle gespielt hat. Was ist denn die besondere Herausforderung bei der Begleitung von Stummfilmen?
Das Timing – also dass man immer synchron am Film bleibt. Wenn z.B. im Film eine Vase zu Bruch geht, muss man auch wirklich synchron zur Vase den Gong kriegen. Oder, wenn jemand an die Tür klopft, dass man das nicht vergisst, oder, wenn eine Dampfzugpfeife geht. In dem Moment, in dem man es im Film sieht, ist es schon zu spät.
Wie merken Sie sich das? Und wie lange müssen Sie üben, bis Sie das drauf haben?
Zu lange (lacht). Es gibt andere Organisten, die besser improvisieren können als ich. Ich spiele eher nach Noten, was aber auch Vorteile hat, denn ich finde, komponierte Musik ist eigentlich immer besser als die Musik, die man improvisiert.
Was für Musik spielen Sie da?
Klassiker, die ich entsprechend anpasse, aber auch Musik, die direkt für die Stummfilmbegleitung geschrieben wurde. Ich habe von amerikanischen Freunden, die selber noch Stummfilme begleitet haben, jede Menge originale Noten bekommen. Da gibt es dann so Stücke wie „dramatisches Andante“, das kann man immer bei einer dramatischen Liebesszene spielen oder einer Verfolgung oder einer Feuerszene. In Berlin gab es den Komponisten Giuseppe Becce, das war ein Schüler des Klaviervirtuosen und Komponisten Ferruccio Busoni. Von Becce habe ich alle Stücke, die er geschrieben hat. Das sind wirklich gut Sachen.
Und davon konnte man auch bei „Die Frau, nach der man sich sehnt“ etwas hören?
Ein „dramatisches Andante“ war da auf jeden Fall zu hören. Andere Stücke, die ich spiele, heißen z.B. „Premonition“, also „Vorahnung“. Ich improvisiere aber auch bei Stummfilmvertonungen. So ein bisschen im Philipp Glass-Stil. In Bezug auf Marlene Dietrich finde ich den Film „Die Frau, nach der man sich sehnt“ überhaupt viel schöner als den „Blauen Engel“. Man sieht sie da ganz of in Großaufnahme und er eignet sich eben sehr für dramatische Musik.
Gibt es überhaupt einen Lieblingsfilm von Ihnen?
Ich begleite sehr gerne „Nosferatu“. Den habe ich zweimal bei der Langen Nacht der Museen gespielt. Ein toller Film, sehr dankbar für die Begleitung auf der Kinoorgel.
Sie treten bei den Stummfilmbegleitungen auch immer im Smoking auf. Hat das einen Grund?
Ja. Das war früher so üblich. Da sind die Stummfilmorganisten immer im Smoking aufgetreten. Das war ein richtig festliches Ereignis. Da gehörte das dazu.
Das Interview führte Katrin Herzog.
Die Serie mit Stummfilmklassikern im Musikinstrumenten-Museum wird mit Billy Wilders „Menschen am Sonntag“ am 7. Dezember fortgesetzt. Es folgt „Das Cabinet des Dr. Caligari“ am 18. Januar 2017 sowie Friedrich Wilhelms Murnaus „Der letzte Mann“ am 15. Februar. Begleitet werden die Filme abwechselnd von Jörg Joachim Riehle und Anna Vavilkina.
Der Eintritt kostet 6 Euro. Karten können telefonisch unter 030/254 811 78 oder per Mail vorbestellt werden. Die Abendkasse öffnet um 17 Uhr.
Außerhalb der Stummfilm-Reihe wird die Wurlitzer-Orgel immer donnerstags um 18 Uhr und samstags um 12 Uhr im Anschluss an die öffentlichen Führungen gespielt.