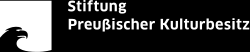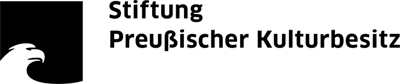Der Tod und das Mädchen – Ein Dunkelkonzert
News vom 16.01.2017
Vier junge wilde Männer, die mit zwei Violinen, einer Viola und einem Cello davon erzählen, wie der Tod ein Mädchen trifft und es verführt, sanft in seinen Armen einzuschlafen. Das verspricht sinnliche Intensität, das verspricht existenzialistische Schauder, das verspricht einen Hauch von Schreckromantik. Noch intensiver wird das Konzerterlebnis durch die Art der Darbietung: im stockdunklen Curt-Sachs-Saal des Musikinstrumenten Museums des Staatlichen Instituts für Musikforschung. Wir haben mit den vier Musikern gesprochen – dem vorzüglichen Vision String Quartet, das u.a. 2016 beim Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb (FMBHW) abräumte: den ersten Preis im Fach „Streichquartett“, den Sonderpreis für die beste Interpretation und den Preis der Freunde Junger Musiker Deutschland.

Sie geben am 21. Januar ein Konzert in der „Konzertreihe der Deutschen Musikhochschulen“ im Berliner Musikinstrumenten-Museum – und zwar gänzlich ohne Licht. War das Ihre Idee? Und warum spielen Sie gerade Franz Schuberts „Der Tod und das Mädchen“?
Wir wurden von Herrn Nordmann, dem künstlerischen Leiter des Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerbs, gefragt, ob wir ein Dunkelkonzert spielen wollen – ursprünglich für den Schubert-Marathon im Konzerthaus. Leider konnten wir zu diesem Termin nicht, darum spielen wir das Konzert jetzt zu einem anderen Zweck woanders, nämlich eben im Musikinstrumenten-Museum. Dann haben wir nachgedacht und gefunden, dass sich „Der Tod und das Mädchen“ wirklich ausgesprochen gut dazu eignet, im Dunkeln gespielt zu werden. Man kann Emotionen doch ganz anders spüren, wenn man einen Sinn weniger hat und deswegen die anderen Sinne automatisch geschärft sind. Dunkelheit bedeutet ja auch Nacht, Angst, ist alles Mögliche, oder kann es zumindest sein, deswegen kann natürlich Musik solche Effekte sehr verstärken. Wir haben außerdem schon ein Dunkelkonzert gespielt, im Sendesaal Bremen, und haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Das war eines unser absolut liebsten Konzerte, die wir jemals gespielt haben. Als die Anfrage kam, dachten wir natürlich prima, und wenn, dann auch wirklich dunkel, denn dann macht es allen mehr Spaß.
Was sind die Herausforderungen beim Spielen im Dunkeln?
Zunächst muss man den Konzertsaal dunkel kriegen. Da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die zu beachten waren, damit es wirklich total finster ist. Als wir uns beispielsweise den Curt-Sachs-Saal angeschaut haben, gab es zwei defekte Lampen, was in diesem Fall bedeutete, dass sie nachleuchten, wenn sie ausgeschaltet sind. Die mussten erst noch ausgetauscht werden. Oder ein leicht blinkender W-Lan-Router, der verdunkelt werden muss. Dann muss man natürlich üben, komplett bei Dunkelheit zu spielen. Das ist nicht ganz einfach, weil man spüren muss, wo das Instrument anfängt, wenn man den Bogen aufsetzt und nichts sehen kann. Erschwert ist auch die Kommunikation untereinander, die Einsätze müssen alle übers Gehör, also über Atemgeräusche gehen – nicht wie sonst, wenn man ihn einfach nur stumm mit Geigenbewegung geben kann. Das muss man natürlich üben. Aber wenn man sich wirklich aufs Gehör und darauf, wie die anderen spielen verlässt, merkt man, dass man deutlich besser zusammen ist.
Was bedeutet das für die Zuhörer? Hört sich Musik im Dunkeln anders an?
Bestimmt. Ich hab noch nie eins gehört, ich hab nur eins gespielt bisher. Für mich hat es sich sehr anders angehört.
Es heißt, Sie spielten immer auswendig. Warum eigentlich?
Damit wir auch im Dunkeln spielen können, natürlich.
Sie haben insgesamt nicht nur einen Preis, sondern schon mehrere Preise beim Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb gewonnen. Wie wichtig sind solche Preise eigentlich noch für Musiker wie Sie, die ja schon erfolgreich auftreten?
Der Gewinn war der Startschuss für weitere Wettbewerbe. Beim Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb haben wir bei eher nationaler Konkurrenz einmal geschaut, wie so ein Wettbewerb für uns abläuft, uns an die Situation von so einem Wettbewerb gewöhnt. Und natürlich hat ein Wettbewerb immer schöne Anschlussmöglichkeiten. Wir haben gleich am nächsten Tag entschieden, auch mal bei einem richtig großen, internationalen Wettbewerb mitzumachen – mit noch mehr Runden, mit noch mehr Repertoire. Das war der „Concours de Genève“, durch den sich uns viele Möglichkeiten, vor allem im internationalen Raum, eröffnet haben. Diese Entscheidung hätten wir nicht getroffen, wenn wir nicht davor so positive Erfahrungen beim Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb gehabt hätten. Die Fragen stellten Gesine Bahr-Reisinger und Birgit Jöbstl