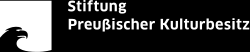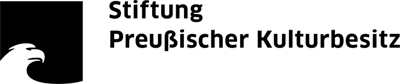Soirée für einen Jahrhundertkünstler
News vom 14.03.2018
Am 8. März 2018 würdigte das Staatliche Institut für Musikforschung den großen Pianisten Josef Hofmann mit einer Soirée, bei der die Übergabe von Briefen, Fotos und Dokumenten aus seinem Nachlass an das Archiv des SIM gefeiert wurde. Außerdem erhielt das Musikinstrumenten-Museum von den Erben Hofmanns ein überlebensgroßes Jugendporträt des Pianisten der polnischen Malerin Anna Bilińska aus dem Jahr 1890 als Dauerleihgabe.

Ganz sanft kommen die ersten Töne aus dem Steinway-Flügel neben dem Wurlitzer-Spieltisch im vorderen Bereich des Musikinstrumenten-Museums. Sie steigern sich, bis der schnelle Tastenschlag von Mendelssohns Rondo Capriccioso (Op. 14) den ganzen Raum erfüllt. Klar klingt jeder einzelne Ton aus dem 1916 gebauten Instrument. Der zweite Blick zum Instrument offenbart, was das Besondere an der Vorführung ist: Der Klavierstuhl vor dem Flügel ist leer und das Instrument spielt scheinbar ganz von alleine. Es handelt es sich um einen – wie im Bestandskatalog des Museums zu lesen ist – Hammerflügel mit pneumatischer Spielvorrichtung, also um eines der wenigen heute noch erhaltenen „Welte-Mignon-Reproduktionsklaviere“, dem ersten mechanischen Musikautomat überhaupt. Was den Zuhörer noch heute an dieser Technik fasziniert ist die nahezu authentische Reproduktion von Klavierstücken, d.h. auch die Anschlagsdynamik wird weitestgehend original wiedergegeben. Und tatsächlich könnte man, wenn nicht das Rattern der Walzen wäre, vergessen, dass kein Virtuose vor dem Flügel sitzt, sondern eine Maschine die Klänge produziert, die vor mehr als 100 Jahren auf eine papierene Notenrolle gebannt wurden. Doch nicht nur das Instrument ist etwas ganz Besonderes: Die Aufnahme ist eine von 21 Einspielungen, die der große Pianist Josef Hofmann zwischen 1905 und 1913 aufnahm und die heute im Staatlichen Institut für Musikforschung aufbewahrt werden. Nun wird die Hofmann-Sammlung durch die Archivalien aus dem Nachlass des Musikers und das Jungendporträt komplettiert.
Schon im Jahr 2016 wurde dieser wichtige Teil des Nachlasses von Josef Hofmanns vom Großneffen des Musikers dem Staatlichen Institut für Musikforschung übergeben. Er besteht aus 1,2 laufenden Metern an persönlichen Dokumenten, Notenmanuskripten, Autographen und Konzertprogrammen von Josef Hofmann und seiner Familie. Der Nachlass bereichert den Bestand des Staatlichen Instituts für Musikforschung an Musikernachlässen und Dokumenten des Musiklebens, die ein wichtiges Fundament für die Forschungsarbeit des Instituts und den Bestand der Institutsbibliothek bilden. Derzeit sind Stücke aus dem Hofmann-Nachlass im Musikinstrumenten-Museum in einer kleinen Kabinettausstellung zu sehen.
Auch das 1890 gemalte Jugendporträt Hofmanns ist nun der Öffentlichkeit zugänglich. Gemalt hat es 1890 in Warschau die ukrainische Künstlerin Anna Bilińska. Sie gehörte zur ersten Generation professioneller Künstlerinnen, die an privaten Kunstakademien studieren und an Ausstellungen teilnehmen durften, wie die Kunsthistorikerin Agnieszja Bagińska vom Nationalmuseum Warschau erläutert. Bilińska spezialisierte sich auf Porträtmalerei und nahm Aufträge von Adligen und Intellektuellen an. Minutiös dokumentierte sie in ihren Notizbüchern, wie viel Zeit sie für die Fertigstellung des Gemäldes brauchte und wie viel Geld sie dafür bekam. Agnieszja Bagińska hat sich auf das Werk der Malerin spezialisiert und weist auf die große Bilińska-Ausstellung hin, die nächstes Jahr im Nationalmuseum Warschau zu sehen sein wird. Das Bildnis von Hofmann, das im Musikinstrumenten-Museum als Dauerleihgabe der Erben des Pianisten an prominenter Stelle neben Max Liebermanns Portrait von Richard Strauss hängt, zeigt den jungen Künstler im Alter von 14 Jahren, lässig an sein Arbeitsgerät gelehnt, eine Hand hält er schwebend über die Tasten, dem Betrachter selbstbewusst und zielstrebig in die Augen blickend. „Ich denke schon seit vielen Jahren darüber nach, dass das Porträt in unserer Wohnung eigentlich nicht am richtigen Platz ist, sondern dass Josef Hofmann es verdient, auch in der Öffentlichkeit gesehen zu werden.“ Georg Metz, Großneffe Josef Hofmann, überlegte lange, welcher Ort der Beste für die Präsentation des Gemäldes sei – schließlich fiel die Entscheidung auf Berlin, vor New York oder Krakau: „Es ist besonders schön zu sehen, dass es nach so langer Zeit gelungen ist, den besten Ort für das Gemälde zu finden. Es schließt sich für uns ein Kreis. Während Josef Hofmann selbst ein Weltbürger war, war die Hofmann-Familie doch Berlin sehr verbunden. Insofern ist es sehr schön, dass sein Bild nun in Berlin gezeigt wird.“
Josef Hofmann – das Wunderkind am Klavier, das die Bühnen der Welt eroberte und sein Publikum in Ekstase versetzte. 1876 in Krakau geboren, debütierte er mit 10 Jahren in den USA und gab in den 70 Tagen danach 52 Konzerte, bis die in New York ansässige „Gesellschaft zur Verhütung von Grausamkeiten an Kindern“ intervenierte. Alfred Corning Clark, Sohn des Mitgründers der Singer Nähmaschinenfabrik Edward Clark, spendete 50.000 Dollar, damit der junge Künstler bis zu seinem 18. Geburtstag keine öffentlichen Konzerte mehr geben musste. Er studierte bei Moritz Moszkowski in Berlin und Anton Rubinstein in Dresden und bereiste anschließend als Virtuose die ganze Welt. 1937 gab er sein 50-jähriges amerikanisches Bühnenjubiläum in der New Yorker Metropolitan Opera – der Höhepunkt seiner Karriere. Erhalten ist eine Photographie davon, die Josef Hofmann am Flügel zeigt. Im Hintergrund die 3600 Sitzplätze des Opernhauses dicht auf dicht mit Zuhörern belegt.
Doch Josef Hofmann hatte noch eine weitere Leidenschaft: Schon als Kind begeisterte er sich für Technik und Erfindungen. In jungen Jahren entwickelte er eine Vorrichtung, die ihm half, trotz seiner geringen Körpergröße die Pedale des Klaviers zu erreichen. Insgesamt meldete er rund 70 Patente an. Die Anzahl der Kompositionen aus seiner Feder ist wesentlich geringer. Autos begeisterten ihn und inspirierten ihn zu vielen Erfindungen wie beispielweise den Scheibenwischer. Hofmann beschäftigte sich auch mit der Frage, wie man bei Aufnahmegeräten für selbstspielende Klaviere die Dynamik erfassen kann. So kommt es nicht von ungefähr, dass er selbst 21 Musikwerke auf einem „Welte-Mignon-Reproduktionsklavier“ einspielte. Hierbei werden auf speziellen Reproduktionsklavieren Löcher in sogenannte „Notenrollen“ oder „Klavierrollen“ eingestanzt, die beim Abspielen abgetastet werden und so den Spielmechanismus im Gang setzen. Das Musikinstrumenten-Museum besitzt ein solches seltenes, noch funktionstüchtiges Reproduktionsklavier. Und so kann bei der Soirée im Musikinstrumenten-Museum der charakteristische Tastenanschlag Josef Hofmanns auch nach über 100 Jahre die Zuhörer in Begeisterung versetzen.
Text: Friederike Schmidt