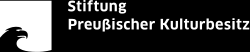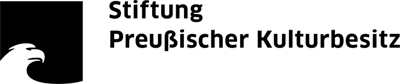Beethoven spazierte nicht endlos im Sonnenschein
News vom 19.02.2020
Wie das Staatliche Institut für Musikforschung und sein Musikinstrumenten-Museum Kindern und Jugendlichen den Komponisten nahebringen will - Am Sonntag startet das Vermittlungsprogramm »B and Me!«

Überall Beethoven satt in diesen Tagen. Alle Sinfonien hier, alle Sonaten dort. CD-Boxen, wer noch Zeit dafür hat. Im Musikinstrumenten-Museum des Staatlichen Instituts für Musikforschung kann man in diesem Jahr nicht nur hören, wie Beethoven zu seiner Zeit geklungen hat und wie man ihn eigentlich richtig spielt, das Haus neben der Berliner Philharmonie setzt speziell auf die Vermittlung. Die Kulturstaatsministerin fördert ein Projekt, das sich »B and Me!«nennt und Kindern und Jugendlichen einen Künstler nahebringen will, der mehr war als nur ein genialer Tonsetzer, sondern ein Mann, der oft genug mit dem Kopf durch die Wand wollte. Fragen an die Direktorin des Musikinstrumenten-Museums, Conny Restle, und Mireya Salinas, die im Haus für die kulturelle Bildung zuständig ist.
Was bitte ist denn eine Beethoven-Lounge?
Salinas: Die Beethoven-Lounge ist ein Ort der Kommunikation und des Meinungsaustauschs mitten im Musikinstrumenten-Museum, man kann Musik hören und schmökern in Beethoven-Literatur aller Art. Wir versuchen, differenzierte Zugänge zu bieten: Kinder können sich auf den Boden setzen und das Beethoven-Memory spielen, Selfies im Beethoven-Kostüm machen oder die Rätsel im Beethoven-Entdeckerheft lösen. Aber man kann auch in die großen Lebensthemen Beethoven eintauchen, dazu lädt beispielsweise die Abbildung des Heiligenstädter Testaments ein, die beim Aufklappen auch den gesamten Text in lesbarer Form bietet – Beethovens Handschrift war eben recht krakelig!
Restle: Die Beethoven-Lounge ist ein Ort im Museum, der ganz der Person Beethovens gewidmet ist. Er ist zentraler Veranstaltungsort für unsere Angebote im Rahmen von »B and Me«, zu ihr führen im Beethoven-Jahr alle Wege im MIM. Sie wird aber auch das Zentrum sein für die Reihe »Beethoven Science«, in der Wissenschaftler*innen über Ihre Forschungsprojekte zu Beethoven berichten werden.
Sagt Kindern und Jugendlichen Beethoven überhaupt noch was, und wen möchten Sie mit Ihrem Vermittlungsprogramm »B and Me!« erreichen?
Salinas: Zunächst einmal: Ja, wir wollen Kinder und Jugendliche erreichen. Außerdem möchten wir aber auch einen Zugang für Menschen bieten, die vielleicht nicht oft ins Museum gehen und bisher noch keine großen Kenntnisse über Ludwig van Beethoven oder die klassische Musik haben. Beethoven eignet sich aus meiner Sicht besonders gut, weil sein Leben eben kein endloser Spaziergang im Sonnenschein war. Jugendliche revoltieren doch zum Beispiel mitunter gegen gängige Normen der Gesellschaft, da können wir an Beethovens sehr selbstbewusstes Auftreten gegenüber dem Adel anknüpfen: »Fürsten hat es und wird es noch Tausende geben; Beethoven gibt's nur einen!«Viele Menschen fragen sich auch, wie Beethoven überhaupt komponieren konnte, obwohl er mit 28 Jahren bereits schwerhörig und später nahezu taub war, diesem Thema haben wir den Workshop »Beethovens Gehör« gewidmet.
Restle: Wir möchten Interesse wecken für die Klangwelt Beethovens, die Teil seines Kosmos war, und mit der er sich am besten artikulieren konnte. Es braucht aber Zeit und Muße, um sich dem Lebensraum Beethovens nähern zu können, weswegen wir in der Beethoven-Lounge zahlreiche Sitzgelegenheiten mit Lese- und Hörmöglichkeiten anbieten – quasi eine Oase des sich Versenkens in Beethovens Klangwelt. Essentials daraus bieten wir als Tool »Beethoven digital« in unserem Digitalen Museumsguide an, das wir am 26. März 2020 vorstellen werden.
Stimmt es, dass Sie Beethoven als ganz heutige Figur präsentieren werden? Wenn ja, wie machen Sie das?
Salinas: Ganz so stimmt das nicht – aber manche seiner Lebensthemen sind zeitlos interessant, wie er zum Beispiel mit seiner fortschreitenden Ertaubung umging. Bei seiner Begabung muss er ja ein ausgezeichnetes Gehör gehabt haben, der Verlust dieses so wichtigen Sinnes hat ihn fast verzweifeln lassen. Aber hat sich nicht aufgegeben: Nachdem Beethoven akzeptieren musste, dass Heilung nicht möglich ist, schuf er in den folgenden Jahren ein Meisterwerk nach dem anderen! Wir nennen das heut Resilienz. Neben denjenigen, die seine Musik kennen und lieben, können wir also alle ansprechen, die sich für Beethoven auch als Menschen interessieren.
Restle: Beethoven hat als Komponist und als Virtuose viel und äußerst erfolgreich experimentiert. Und Experimente können Wege aus einer Erstarrung aufzeigen. Auf ähnliche Weise nähern sich auch viele Musiker*innen der heutigen Kreativkultur den aktuellen Fragen der Musik: Welches sind die interessantesten Klangwerkzeuge, was sind die Grenzen der Klanglichkeit, in wieweit findet eine Mechanisierung der Musik statt? Wie viele Künstler der Gegenwart war Beethoven zum Teil angepasst, zum Teil aber höchst unkonventionell. Insofern ist Beethoven für mich in unseren Tagen aktueller denn je. Und dieses Unkonventionelle bei Beethoven versuchen wir herauszuschälen.
Natürlich werden auch andere Institutionen Vermittlungsprogramme zum Thema Beethoven auflegen. Was kann nur das MIM, was andere nicht können?
Salinas: Schauen Sie sich um, das liegt ja gewissermaßen auf der Hand!
Restle: Wir können mit unserem einzigartigen Museumsbestand die Klangwelt Beethovens erfahrbar machen. In erster Linie sind es sicherlich die Hammerclaviere der Beethovenzeit, die veranschaulichen, welche spieltechnischen und klanglichen Möglichkeiten dem Virtuosen, dem »Tastenlöwen« Beethoven zur Verfügung standen. Und es ist die Vielzahl der historischen Instrumente des Orchesters zur Beethovenzeit, die sich vom modernen Instrumentarium zum Teil signifikant unterscheiden, und die in unserem Digitalen Museumsguide im Rahmen der Beethoven-Tour zu hören sind.
Am 10. März wird die große Beethoven-Ausstellung der Staatsbibliothek im Haus Unter den Linden eröffnet. Welche Verbindungen gibt es zwischen den beiden SPK-Institutionen im Jubiläumsjahr?
Restle: Im Rahmen unserer Gesprächsreihe »Beethoven Science« wird Martina Rebmann, die die Musikabteilung an der Staatsbibliothek leitet, am 19. März ausführlich über ihre große Ausstellung »Diesen Kuß der ganzen Welt«berichten. Die Musikabteilung der Staatsbibliothek besitzt ja die weltweit größte und bedeutendste Sammlung an Beethoven-Autographen. Das Autograph der 9. Symphonie wurde 2001 sogar ins UNESCO-Register »memories of the world« eingetragen. Darüber hinaus sprechen wir bei »Beethoven Science« noch andere spannende Themen der Ausstellung in der Staatsbibliothek an, wie z. B. die Frage nach dem richtigen Tempo beim Spiel Beethovenscher Werke, oder die Frage nach der Stimmung der Klaviere Beethovens. Auch unsere Beethoven-Konzerte im Rahmen der Reihe »Alte Musik live« greifen zwei zentrale Themen dieser Ausstellung auf: Am 10. Mai um 11 Uhr stehen Streichquartett-Kompositionen von Beethoven, Pierre Rode und Ferdinand Ries mit dem Schuppanzigh-Quartett im Mittelpunkt, die auf Beethovens eigenen Streichinstrumenten aus unserer Sammlung erklingen werden; und am 17. Mai lässt Tom Beghin die »Waldstein-Sonate« sowie die »Appassionata« ̶ zwei zentrale Werke der Klavierliteratur ̶ auf einem neuen, sensationellen Nachbau der Werkstatt Chris Maene von Beethovens eigenem Érard-Flügel erklingen. Die vier Streichquartett-Instrumente Beethovens zählen zu den Zimelien unserer Sammlung. Sie befinden sich seit 1891 als Dauerleihgabe im Beethoven-Haus Bonn und kehren nun speziell für dieses Konzert für eine kurze Zeit nach Berlin zurück. Um sich den Autographen und Instrumenten Beethovens spielerisch zu nähern, haben wir mit Materialien aus der Musikabteilung der Staatsbibliothek und dem Beethoven-Haus Bonn ein »Beethoven Memo« für junge und erwachsene Beethoven-Fans entwickelt, das wir an unserer Museumskasse für einen geringen Unkostenbeitrag zum Kauf anbieten.
Die Fragen stellte Ingolf Kern.