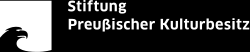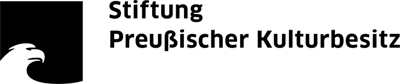Durchlässig und archaisch: Jacques Herzog über den Vorentwurf für das Museum des 20. Jahrhunderts
10.10.2018Durchlässig und archaisch: Jacques Herzog über den Vorentwurf für das Museum des 20. Jahrhunderts
Das Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron gestaltet das neue Museum des 20. Jahrhunderts auf dem Kulturforum. Zusammen mit den Staatlichen Museen zu Berlin entwickeln die Architekten den Wettbewerbsentwurf weiter. Im Interview spricht Jacques Herzog darüber, was bei einem Museumsbau im 21. Jahrhundert zu beachten ist und warum der Entwurf so gut zum Kulturforum passt.

Im Oktober 2016 hat das Architekturbüro Herzog & de Meuron mit seinem Entwurf den Wettbewerb für das Museum des 20. Jahrhundert am Berliner Kulturforum gewonnen: mit einem Gebäude in archetypischer Hausform und durchlässiger Backsteinfassade, in dessen Innerem sich zwei Boulevards kreuzen. Der Berlin-typische Spitzname ließ nicht lange auf sich warten und der Neubau wurde ganz salopp „Scheune“ getauft. Seit Januar 2018 haben Herzog & de Meuron den Entwurf in enger Absprache mit den künftigen Nutzern, den Staatlichen Museen zu Berlin, zum Vorentwurf weiterentwickelt – oder, wie es Nationalgaleriedirektor Udo Kittelmann am Tag der Präsentation sagt: Aus der Schachtelscheune ist ein Museum geworden. Und zwar eines, das den Ansprüchen der Museumsbesucher im 21. Jahrhundert gerecht wird, die sich laut Kittelmann in den letzten zehn Jahren radikal geändert haben: Heutzutage sei ein Museum immer auch ein Versammlungsort, ein Debattenraum mit demokratischem Rahmen.
Der Neubau hat also einige Erwartungen zu erfüllen – unter anderem soll er auch dem wegen seiner Fragmentierung und „Öde“ oft als „Unort“ bezeichneten Kulturforum städtebauliche Heilung bringen. Darum beginnt Jacques Herzog seine Vorentwurfspräsentation auch mit den Worten „Unser städtebauliches Konzept für das Kulturforum ist ein Konzept der Dichte, nicht der Leere“. Was er damit meint und wie man ein Museum des 21. Jahrhundert baut, hat er im Gespräch im Anschluss an die Podiumsdiskussion am 9. Oktober 2018 kurz erläutert.
Architektur für die Kunst - Die aktuellen Planungen für das Museum des 20. Jahrhunderts
Audiomitschnitt der Diskussionsveranstaltung vom 9. Oktober 2018
© SPK
Jacques Herzog über den Neubau für das Museum des 20. Jahrhunderts
-
Transkript ein- / ausblenden
Transkript
Sie haben den Entwurf gemeinsam mit den Staatlichen Museen weiterentwickelt. Wie hat diese Zusammenarbeit konkret ausgesehen?
Wir wollen die Wünsche der Museumsbetreiber, der Kuratoren, der Künstler erfüllen. Das ist ja ein wichtiger Grund, weshalb wir auch schon viele Museen gebaut haben auf der ganzen Welt, weil wir diese Liebe zur Kunst haben und weil wir uns da treiben lassen von diesen Wünschen, die aus dieser Ecke kommen. Wir sind keine Architekten, die da irgendwie was basteln, und ihre eigenen Vorstellungen realisieren wollen, die nicht irgendwie aus dieser Welt stammen. Da würde jemand offene Türen einrennen bei uns. Von daher gesehen war der Dialog stets total offen. Wir wollen immer das Gleiche letztlich: Der Bauherr, wie er hier aufgestellt ist, und der Architekt quasi wie eine Art Komplizenschaft für ein gemeinsames Ziel.
Wie baut man ein Kunstmuseum für das 21. Jahrhundert?
Museen, seit es sie gibt: Es gibt nur gute und nicht gute. Solche, die funktionieren beim Publikum und bei den Menschen, die dahin gehen und für die Kunst, und solche, die das weniger tun. Ein Museum – sogar aus dem 18. Jahrhundert, wenn man nur an den Louvre denkt, der ja als Königspalast gebaut wurde und nun Museumsfunktion hat – der funktioniert wunderbar für die Kunst dieser alten Meister. Er würde aber auch für eine Kunstgalerie von heute funktionieren, weil es ein guter Bau ist. Man könnte auch darin Performances machen, darin Filme zeigen. Das heißt, ich bin sehr skeptisch, wenn es heißt, jetzt ist das ein Museum für das 21. Jahrhundert und man muss jetzt alles anders machen. Aber was sicher wichtig ist, hier in Berlin sieht man das, dass ein Museum immer an einem Ort richtiger oder weniger richtiger, besser oder weniger gut funktioniert. Und hier war, wie wir das hier vorstellen konnten, diese archaische Form, die als einzige meiner Meinung nach, von den Wettbewerbsprojekten funktionierte, im Zusammenspiel mit der Abstraktion von Mies und dem organischen Spiel von Scharoun, diese quasi banale Form, plötzlich, wow! hat das so eine provozierende Einfachheit. Und da war es aber wichtig eben auch dann – und jetzt kommen wir zum Museum des 21. Jahrhunderts – diese Durchlässigkeit zu schaffen, die ja in einem gewissen Widerspruch ist zu dieser archaischen Grundform. Mit diesen großen, Hangar-ähnlichen Toren, die aber wie Wände funktionieren, wird quasi diese Archaik ja irgendwie auch konterkariert. Das heißt, es gibt so eine Ambivalenz zwischen dem einen und dem anderen Punkt. Das ist vielleicht typisch für unsere Zeit, das wäre zur Zeit von Mies und von Scharoun, oder noch früher, nicht in dem Maße möglich gewesen. Das ist ein zeitgenössisches Element. Aber sonst hat der Bau ja Züge, Wesenszüge dieser Urform, gerade unser Entwurf, der ja auch zwei, drei oder vierhundert Jahre alt sein könnte. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie wir Architektur denken. Das Heute und das Gestern ist seinerseits natürlich völlig unterschiedlich, aber es ist ja nicht so, dass das, was früher war, nicht mehr funktioniert und dass das keinen Wert mehr hat, sondern es gibt in uns tief drinnen, in uns Menschen ja auch so Sehnsüchte, fast hätte ich gesagt, wie bei Platon, so Urbilder, die immer irgendwie wieder funktionieren. Wenn man ein Kind fragt, von heute, zeichne mir ein Haus! Die meisten Kinder irgendwo auf der Welt würden ein Haus zeichnen mit dieser typischen Hausform, das heißt, es gibt solche Bilder, und die sind eben auch durchaus fürs 21. Jahrhundert brauchbar und geeignet.
Ist der Museumsneubau jetzt die „Vollendung“ des Kulturforums?
Das Forum, die Forumsidee ist ja, wie ich versuchte zu sagen, ein Konzept der Dichte, das heißt der Nähe von Gebäuden und auch von den Institutionen. Durch diese Nähe wird eine Art Forum entstehen, das heißt, ein Austausch, ein Ort des Austauschs zwischen dem gespeicherten Wissen der Bibliothek, zwischen dem Gedächtnis der Bibliothek, zwischen der Welt der Musik in der Philharmonie und diesem kirchlichen und trotzdem auch sehr zeitgenössischen Programm, welches die Kirche hat. Forum ist nicht ein säulenumstandenes Loch, oder ein Leeres, sondern ist genau diese Nähe. Und es gibt da zwischen diesen Gebäuden, zwischen diesen Objekten ganz spezifische Außenräume, die ganz unterschiedlich sind und wo die Menschen dann auch ganz unterschiedliche Bewegungsabläufe, Verhaltensformen dann auch leben können.
© SPK / Gesine Bahr
Planungsstand Frühjahr 2021

Herzog & de Meuron
Herzog & de Meuron ist eine Partnerschaft, die von Jacques Herzog und Pierre de Meuron mit den Senior Partnern Christine Binswanger, Ascan Mergenthaler und Stefan Marbach geführt wird. 1978 gründeten Jacques Herzog und Pierre de Meuron ihr gemeinsames Büro in Basel. Die Partnerschaft ist über die Jahre gewachsen. Herzog & de Meuron hat Büros in Basel, Hamburg, London, New York City und Hong Kong.
Zu den bedeutenden Gebäuden für Kulturinstitutionen, die Herzog & de Meuron entworfen und realisiert haben, zählen unter anderem: die Londoner Tate Gallery of Modern Art (2000) und ihr sagenhafter Erweiterungsbau (2016), das Vitra Haus (2009) und das Vitra Schaudepot (2015) in Weil am Rhein, die Erweiterung und Renovierung des Musée Unterlinden in Colmar, Frankreich (2015), das Museum der Kulturen in Basel (2010) sowie die Hamburger Elbphilharmonie (2017).