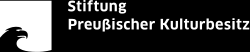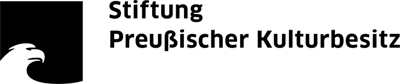Bereichsnavigation
Zum Welfenschatz – SPK klärt verbliebene Fragen
Pressemitteilung vom 05.02.2025
Zu den aktuellen Berichten zum Fall des Welfenschatzes nimmt die SPK wie folgt Stellung: Die SPK hat der Beratenden Kommission dargelegt, dass sie einer Befassung zustimmen würde, sofern die Voraussetzungen entsprechend der Verfahrensordnung geklärt sind. Um dies zu erreichen, hat sie nun erneut Kontakt mit der Kommission und den Anwälten der Nachfahren von Alice Koch aufgenommen, um die noch offenen Fragen zu klären.
Die SPK bekennt sich unmissverständlich zu den Washingtoner Prinzipien von 1998 und ihrer Umsetzung in Deutschland. Sie hat der Beratenden Kommission mit Schreiben vom 25. September 2024 dargelegt, dass sie einer Befassung der Kommission zustimmen würde, aber zunächst noch Fragen unter anderem zur Berechtigung der einzelnen Anspruchsteller zu klären sind, wie es die Verfahrensordnung der Kommission von 2016 vorsieht. Darauf hat die Beratende Kommission gegenüber der SPK nicht reagiert. Über die aktuellen öffentlichen Aussagen des Vorsitzenden ist die SPK daher überrascht, hat sich jedoch mit Schreiben vom 4.2.2025 erneut an die Kommission gewandt mit der Bitte um kurzfristiges Gespräch über die Klärung der offenen Vorfragen. Gleichzeitig hat sie auch die Anwaltlichen Vertreter der Nachfahren von Alice Koch um ein erneutes Gespräch gebeten, um die noch offenen Fragen zu klären.
Zum Fall
Der Welfenschatz ist seit 2008 Gegenstand verschiedener Restitutionsforderungen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat seitdem wiederholt gründliche und umfangreiche Recherchen zu den Umständen des Welfenschatz-Verkaufs 1935 durchgeführt. Auch nach Erhalt der neuen Unterlagen im Jahr 2022 durch neue Antragsteller hat sie nochmals vertiefte Forschungen angestellt und sich mit den historischen Fakten beschäftigt.
2014 hat die Beratende Kommission erstmals eine inhaltliche Empfehlung ausgesprochen. Sie folgte dabei der Auffassung der SPK, dass der Verkauf nicht als verfolgungsbedingte Veräußerung einzuordnen ist, da der Kaufpreis angemessen war und die Verkäufer diesen zur freien Verfügung erhielten. Sie stellte fest: „Obwohl die Kommission sich des schweren Schicksals der Kunsthändler und ihrer Verfolgung in der NS-Zeit bewusst ist, liegen keine Indizien vor, die darauf hindeuten, dass die Kunsthändler und ihre Geschäftspartner in dem (...) speziellen Fall in den Verhandlungen – etwa von Göring – unter Druck gesetzt worden sind“. Auch aus den neu vorgelegten Dokumenten ergibt sich nach Auffassung der SPK nicht ohne Weiteres, dass der Verkauf des Welfenschatzes im Juni 1935 als verfolgungsbedingter Zwangsverkauf einzuordnen ist.
Anspruchsteller
Die SPK sieht sich konkurrierenden Ansprüchen mehrerer Antragsteller ausgesetzt. Die Verfahrensordnung der Beratenden Kommission besagt, dass eine Befassung der Kommission u.a. voraussetzt, dass „seitens des über das Kulturgut Verfügenden der verfolgungsbedingte Entzug und die Berechtigung der Anspruchsteller (...) geprüft wurde“. Diese Frage der Berechtigung konnte die SPK bislang noch nicht ausreichend klären. Dies hat sie der Kommission im September 2024 bereits erläutert, ohne eine Antwort zu erhalten. Nach den Aussagen des Vorsitzenden der Beratenden Kommission in rbb Kultur vom 1.2.2025 hat die SPK erneut Kontakt mit der Kommission aufgenommen, um eine Klärung der offenen Fragen herbeizuführen.
Der Welfenschatz-Verkauf im Juni 1935 hatte eine mehrjährige Vorgeschichte mit zahlreichen Beteiligten. Vier jüdische Kunsthändler hatten den Welfenschatz 1929 als Vertreter eines größeren Konsortiums erworben, mit dem Ziel, ihn gewinnbringend weiter zu veräußern. Die einzelnen Konsortiumsmitglieder hatten sich an dem Ankauf mit unterschiedlichen finanziellen Summen beteiligt. Die SPK ist mit den anwaltlichen Vertretern dreier Gruppen in Kontakt, die ihre Ansprüche von unterschiedlichen Personen ableiten.
2008 wandten sich Nachfahren der vier Kunsthändler, die als Verkäufer auftraten, an die SPK. Nach der Empfehlung der Beratenden Kommission, die im Jahr 2014 erklärte, dass sie keine Restitution empfehlen könne, versuchten sie ihre vermeintlichen Ansprüche 2015 vor US-amerikanischen Gerichte durchzusetzen. Diese erklärten sich 2023 für unzuständig. Die Anspruchsteller werden von den Rechtsanwälten Stötzel und Urbach vertreten und tragen vor, als Nachfahren der ursprünglichen Vertragsunterzeichner auch weiterhin für das ganze Konsortium handeln zu können. Diese Auffassung teilen die anderen Anspruchsteller nicht.
2022 wandten sich die Anwälte Rosbach und Frémy an die SPK, die neben weiteren Personen einen der Nachfahren von Alice Koch vertreten. Alice Koch war Konsortiumsmitglied mit beträchtlichem Anteil am Welfenschatz. Sie musste im Oktober 1935 Reichsfluchtsteuer entrichten und konnte kurz darauf in die Schweiz fliehen. Anwälte und SPK entschieden gemeinsam, zunächst den Ausgang des US-Verfahrens abzuwarten. Während der noch laufenden Gespräche mit den Anwälten Frémy und Rosbach wandten sich die Anwälte Stötzel und Urbach im März 2024 an die Beratende Kommission. Sie beriefen sich dabei auf die Alice Koch betreffenden Dokumente. Frémy und Rosbach folgten im April 2024.
Eine Gruppe weiterer möglicher Berechtigter, die von einer dritten Anwaltskanzlei vertreten wird, hat die Beratende Kommission nicht angerufen, ist aber mit der SPK in Kontakt. Zu dieser Gruppe gehören ebenfalls Nachfahren von Alice Koch.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz setzt sich nachdrücklich für gerechte und faire Lösungen bei der Restitution von NS-Raubgut ein. Seit 1999 hat sie mehr als 50 Restitutionsbegehren bearbeitet und dabei mehr als 350 Kunstwerke und mehr als 2000 Bücher an die Berechtigten zurückgegeben. Darunter waren eine Zeichnung von Vincent van Gogh, Arbeiten von Munch und „Der Watzmann“ von Caspar David Friedrich.