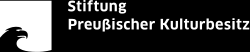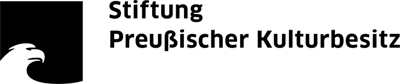Bereichsnavigation
Zwischen Baustelle und Eröffnung – Großarchitekturen der Antikensammlung und des Museums für Islamische Kunst im Pergamonmuseum im Aufbau
Pressemitteilung vom 11.02.2025
Im Frühjahr 2027 werden weite Teile des Pergamonmuseums wiedereröffnet. Antikensammlung und Museum für Islamische Kunst werden sich mit ihren Highlights im Nordflügel und Mittelbau präsentieren. Während in einigen ihrer Räume noch die Bauarbeiten im Gang sind, findet in anderen bereits die Einrichtung mit den antiken Objekten statt.
Ab 2027 werden der Altarsaal und der Saal der Hellenistischen Architektur sowie der Nordflügel des Pergamonmuseums mit der neuen Dauerausstellung des Museums für Islamische Kunst wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Währenddessen werden der Südflügel instandgesetzt, ein neuer vierter Flügel gebaut und die Fußgängerbrücke über den Kupfergraben sowie die Außenanlagen hergerichtet, bis das Haus 2037 wieder vollständig geöffnet ist.
Der Zugang zum teileröffneten Pergamonmuseum wird ab 2027 über den nördlichen, spreeseitigen Abschnitt der Kolonnaden auf der Museumsinsel erfolgen, da der Ehrenhof noch bis Abschluss der gesamten Bauarbeiten als Baueinrichtungsfläche benötigt wird. Der interimistische Eingang zum Haus wird dementsprechend auf dessen Ostseite liegen. Kassen- und Garderobenbereiche sowie Toiletten und Shop werden im Mittelbau in den Räumen unterhalb des Altarsaales eingerichtet. Derzeit werden diese Räume noch baulich hergerichtet.
Im Altarsaal und dem Saal der Hellenistischen Architektur sind bereits zahlreiche Objekte der Antikensammlung restauriert und an ihren Plätzen. Der Pergamonaltar ist gerüstfrei, aktuell werden die Stufen der großen Freitreppe restauriert. Die Fläche vor dem Altar wird derzeit als Zwischenlager für die Fassadenelemente der Mschatta-Fassade genutzt. Sukzessive wurden diese 527 Fassadenelemente seit Ende 2024 in den Nordflügel gebracht und nun dort vor der vorgefertigten Unterkonstruktion aufgebaut. Mit der finalen Verfugung wird diese Arbeit im Herbst 2025 abgeschlossen sein. Parallel dazu werden ab April 2025 im Raum vor der Mschatta-Fassade zwei große Ausstellungsarchitekturen errichtet, entsprechend dem neuen Ausstellungskonzept des Museums für Islamische Kunst. Innovativ, begleitet durch zeitgenössische Interventionen und kommunikative Grafik, werden hier in Fokusräumen zur frühislamischen Geschichte die kulturhistorischen Verbindungen zur Antike, aber auch zu China thematisiert.
Ab Ende 2025 kann dann die Einrichtung des Altarsaales fortgesetzt werden: Fünf weibliche Gewandstatuen von der Altarterrasse, die Dachaufsatzfiguren des Pergamonaltars und die Platten des Telephosfrieses werden in den Folgemonaten dort aufgestellt. Noch bis 31. August sind sie im Pergamonmuseum. Das Panorama zu sehen, das am 1. September für die Umzugsmaßnahmen kurzzeitig schließt. Auch aktuell finden im Altar-saal Aufbauarbeiten statt: Im Telephos-Saal wird derzeit das Hephaistion-Mosaik verlegt. Damit kehrt dieses Mosaik aus den Königspalästen von Pergamon an den Ort zurück, an dem es bereits 1930 gezeigt wurde. Von 1959 bis 2012 war es im Saal der Hellenistischen Architektur zu sehen. Dieser wird durch die Umgestaltung wieder in seiner ursprünglichen Anmutung einer weiten Platzanlage erlebbar. Dort werden in den nächsten Wochen die letzten Objekte ihren Platz einnehmen. Ein Highlight des Raumes bildet die Statue der Athena Parthenos aus der Bibliothek von Pergamon.
Die Räume der Antikensammlung wurden im Wesentlichen auf den historischen Zustand zurückgeführt und behutsam restauriert. Das Pergamonmuseum ist nicht nur einzigartig hinsichtlich der Präsentation antiker Architekturen im Maßstab 1:1, sondern zählt zu den weltweit bedeutendsten Tageslichtmuseen. Lichtdecke und Glasdach wurden vollständig erneuert und neue Dachtragwerke ergänzt. In den 18 Meter hohen Architektursälen wurden deshalb Raumgerüste aufgebaut, die nicht nur eine Arbeitsplattform schufen, sondern auch die im Gebäude verbliebenen Objekte schützten. Nach Fertigstellung der Tageslichtdecke wurden sie demontiert und anschließend der Natursteinboden restauriert. Anders als früher werden künftig aber auch die Nachbarräume zum Altarsaal und zum Hellenistischen Saal als Ausstellungsräume eingerichtet und mit zeitgemäßen Präsentationen ergänzt. Das Museum für Islamische Kunst hat in seinen neuen Räumen hingegen eine vollkommen neue Dauerausstellung geplant. Es wird künftig im Nordflügel auf zwei Etagen vertreten sein, also einer über doppelt so großen Fläche. Die Zahl der gezeigten Objekte ist entsprechend höher als bisher, mit vielen erstmals ausgestellten Werken und spektakulären Leihgaben.
HermannParzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, erklärt: „Die Zeit bis 2027 ist jetzt nicht mehr lang und die Vorfreude wächst, einen beträchtlichen Teil des Pergamonmuseums dann endlich wieder in völlig verändertem Gewand zu sehen: den Nordflügel mit dem Museum für Islamische Kunst auf nun doppelter Fläche so großzügig wie nie, dazu den Pergamonaltar in neuer alter Pracht. Noch ist zwar einiges zu tun, aber jetzt schon ist sichtbar, was uns in zwei Jahren erwartet – eine großartige Neupräsentation.“
Stefan Weber, Direktor des Museums für Islamische Kunst: „Objekte, Themen und Geschichten werden in den 24 Ausstellungsräumen auf neue Weise zugänglich gemacht. Frei nach dem Motto, nicht alles für jeden, sondern für jeden etwas, gibt es ein breites Angebot an digitalen, haptischen und sensitiven Zugängen, die den Besucherinnen eine interaktive und personalisierte Erfahrung bieten. Bereits im Einführungsraum hinter dem Hellenistischen Saal versuchen wir den Spagat zwischen Spätantike und Gegenwart: vor über hundert Jahren war die Berliner Forschung und Museologie mit dem Konzept ‚Islam im Referenzrahmen der Antike‘ zu sehen international bahnbrechend. Für uns heute ist dies in der kulturellen Bildungsarbeit Gold wert: Kulturen fallen nicht vom Himmel, sondern sind verknüpft.“
Andreas Scholl, Direktor der Antikensammlung, erklärt: „Es ist unglaublich viel passiert in den Architektursälen der Antikensammlung – aber vieles davon sieht man nicht auf den ersten Blick. Der Leitgedanke aller Maßnahmen in diesen Räumen war, das denkmalgeschützte Ensemble zu erhalten und die Inszenierung der historischen Ausstellung zu bewahren. Veränderungen, soweit sie nicht auf den ursprünglichen Zustand bei Museumseröffnung 1930 zurückführen, haben wir daher nur äußerst behutsam vorgenommen.“
Highlights
Eines der Highlights des Museums für Islamische Kunst im Pergamonmuseum ist die Mschatta-Fassade. Sie gelangte 1903 als Geschenk des osmanischen Sultans Abdülhamid II. an Kaiser Wilhelm II. nach Berlin. Ursprünglich bildete die über 5 Meter hohe Fassade den prachtvollen Auftakt des sogenannten Mschatta-Palastes im heutigen Jordanien. Ihre Kalkstein-Reliefs zeigen Fabelwesen und Tiere in paradiesischen Gärten. „Die Fassade ist eines der wichtigsten Objekte frühislamischer Kunst, weil sie Elemente aus der römisch-byzantinischen Spätantike und der persischen Kultur verbindet“, erklärt MartinaMüller-Wiener, die stellvertretende Direktorin des Museums für Islamische Kunst.
In dem Bauwerk sind 425 originale Steine sowie 102 Kunststeine verbaut. Diese 527 Blöcke mit einem Gesamtgewicht von 126 Tonnen wurden nach der Schließung des Mschatta-Saales im Obergeschoss des Südflügels im Jahr 2022 Stein für Stein abgenommen. Der Abbau erfolgt nach einem eigens entwickelten Schema, um zusammengehörige Steine später parallel restaurieren und am Ende wieder korrekt zusammensetzen zu können. Bei der Reinigung und Restaurierung wurden etwa Mörtelreste, Zementschlämme, Klebematerialien und Oberflächenauflagerungen entfernt. Im neuen Ausstellungssaal wurde die erste Reihe der Originalsteine auf einen vorgefertigten Sockel vor der Unterkonstruktion aus Beton aufgestellt. Die folgenden Reihen werden sukzessive darüber gesetzt. Jeder Stein ist durch in der Betonwand verankerte Kippanker aus Edelstahl gesichert. Wenn die Fassade wieder steht, werden die Fugen geschlossen, Ergänzungen nachgearbeitet und ggf. Retuschen vorgenommen.
Ziel bei der Aufstellung der Fassade war stets, die Situation am originalen Standort erlebbar zu machen: eine streng symmetrische Anlage mit breitem, mittig platziertem Portal und flankierenden Türmen. Das war aus Platzgründen weder im Bode-Museum noch an ihrem bisherigen Standort im Südflügel des Pergamonmuseums möglich. Leitbild der künftigen Neuaufstellung ist der Auffindungszustand von 1903. Das symmetrische Erscheinungsbild wird wiederhergestellt und der fehlende rechte Teil mit Kunststein ergänzt, so dass die Fassade wieder auf ihrer vollen ursprünglichen Breite von 45 Metern erfahrbar sein wird. Die Kunststein-Rekonstruktion, die jetzt parallel zur originalen Fassade entsteht, ist das Ergebnis eines über mehrere Jahre geführten Dialogs zwischen Museumsfachleuten, Denkmalpfleger:innen, Bauforscher:innen, Restaurator:innen und Steinmetzen. Die Herausforderung besteht darin, einen ausgewogenen visuellen Gesamteindruck zu erzielen, in dem die Rekonstruktion harmonisch an das Original anschließt, ohne ein zu dominantes ästhetisches Eigenleben zu entwickeln.
Der Große Fries im Altarsaal des Pergamonmuseums mit der weltberühmten Darstellung des Kampfes der Götter gegen die Giganten verblieb während der gesamten Bauzeit im Museum. Seine Platten waren bereits zwischen 1996 und 2004 restauriert worden. Ein weiterer Auf- und Abbau der bis zu 2,5 Tonnen schweren und 2,30 Meter hohen Reliefplatten sollte daher vermieden werden. Vor diesem Hintergrund wurde für die Bauzeit ein aufwändiges Paket von Schutz- und Kontrollmaßnahmen geschnürt: Neben Schutzverkleidungen wurde auch hochsensible Messtechnik angebracht. Kleinste Bewegungen von Wänden und Fußböden im Umfeld des Objektes wurden digital erfasst und in Echtzeit an die Bauleiter, Restaurierungsplaner und Verantwortlichen der Antikensammlung übermittelt. Beim Erreichen bestimmter Grenzwerte wurden die Bauarbeiten gestoppt, um Beschädigungen zu verhindern. Gleichzeitig wurde die rekonstruierte Westfront des Pergamonaltars, ebenso wie alle anderen Architekturrekonstruktionen der Antikensammlung, durch restauratorische Überarbeitung in einen strahlenden Zustand versetzt. Dazu gehörte etwa, verschiedene Lagen von Öl- und Dispersionsfarben, die in den vergangenen Jahrzehnten aufgetragen wurden und die Konturen der Profile der Bauelemente unscharf erscheinen ließen, zu entfernen und die bauzeitliche Fassung freizulegen.
Der Telephosfries hingegen wäre im Saal oberhalb der großen Freitreppe des Altars durch die in unmittelbarer Nähe ausgeführten Arbeiten an der tonnenschweren Dachkonstruktion einem zu hohen Risiko ausgesetzt gewesen. Seine 1,60 Meter hohen und damit deutlich kleineren und weniger schweren Reliefplatten werden seit 2018 gemeinsam mit anderen herausragenden Funden aus Pergamon im Pergamonmuseum. Das Panorama gegenüber dem Bode-Museum ausgestellt. Der Telephosfries schmückte die Wände des Innenhofes des Pergamonaltars. Er schildert das Leben des mythischen Helden Telephos, der als Gründer Pergamons und als Ahnherr seiner Herrscherfamilie galt. Von den ursprünglich 74 Reliefplatten aus Marmor sind 47 ganz oder teilweise erhalten. Sie werden alle gezeigt; einzelne, nicht anpassende Köpfe werden in einer Vitrine im Gang unter dem Altar zu sehen sein.
Im Zentrum des Telephos-Saales wird noch bis Mai das Hephaistion-Mosaik verlegt. Es stammt aus einem der Königspaläste auf der Akropolis von Pergamon, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Heiligtums der Stadtgöttin Athena befanden. Fußböden aus vielfarbigen Natursteinen mit geometrischen und vegetabilen Mustern sowie figürlichen Szenen entstanden in Griechenland seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. und entwickelten sich in den darauffolgenden hellenistischen Jahrhunderten zu großer Blüte, vor allem im Umfeld der Königsresidenzen. Das Beispiel aus Pergamon ist eines der wenigen signierten Mosaike. Durch seine illusionistische Machart sticht es noch weiter hervor: Man liest „Hephaistion hat (es) gemacht“ in schwarzer Schrift auf weißem Grund, der wie ein mit Reißzwecken auf dem Boden angepinnter Zettel wirkt, von den sich eine Ecke gelöst hat. Das Mosaik wird wieder, wie schon zwischen 1930 und 1939, im Telephos-Saal präsentiert, wenngleich aus Platzgründen ohne die weitgehend modern rekonstruierten äußeren Felder des Bodens. An der Stelle, an der das Mosaik liegt, befand sich in der Antike der eigentliche Brandopferaltar, von dem sich nur ganz wenige Architekturteile erhalten haben.
In der Mitte des Saals der Hellenistischen Architektur, bereits vom benachbarten Altarsaal aus sichtbar, lenkt die majestätische, deutlich überlebensgroße Marmorstatue der Athena Parthenos aus Pergamon die Blicke auf sich. Es handelt sich um eine hellenistische Skulptur des 2. Jahrhunderts v. Chr. nach einem deutlich älteren, prominenten Vorbild: Der Kultstatue der Stadtgöttin von Athen, der „jungfräulichen“ (Parthenos) Athena des Phidias im Parthenon auf der Athener Akropolis. Das phidiasische Original des 5. Jahrhunderts v. Chr. war deutlich größer und in teuren Materialien (Gold und Elfenbein) ausgeführt. Mit der Wiederholung dieses Werks in kleinerem Maßstab und im Marmor unterstrichen die Könige von Pergamon, dass sie sich dem Vorbild Athens in politischer, künstlerischer und kultischer Hinsicht verpflichtet fühlten. Die Statue der Göttin, in deren Zuständigkeitsbereich unter anderem auch die Künste und Wissenschaften fielen, fand eine sinnfällige Aufstellung in der Bibliothek von Pergamon, die als eine der größten und bedeutendsten der Antike galt. Während der Bauzeit des Pergamonmuseums stand sie einige Jahre höchst prominent als Leihgabe in der Großen Halle des Metropolitan Museum in New York.
Das Pergamonmuseum wird im Rahmen des Masterplans Museumsinsel grundinstandgesetzt und ergänzt. Das nach Plänen von Alfred Messel zwischen 1910 und 1930 errichtete Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und seitdem nie grundlegend saniert. Die Generalinstandsetzung und Ergänzung erfolgen nach Plänen des Architekten O.M. Ungers und unter Leitung des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung. Das Gesamtvorhaben teilt sich in zwei Bauabschnitte, die als zwei separate Projekte durchgeführt werden. Bauabschnitt A umfasst den Nordflügel und den nördlichen Mittelteil des Hauses. Dafür sind Kosten in Höhe von rd. 489 Mio. Euro veranschlagt. Die Bauarbeiten begannen im Januar 2013 im leer geräumten Nordflügel. Der Altarsaal wurde im Herbst des Folgejahres für den Besucherverkehr geschlossen.
Save the date:Pressetermin zu Bauabschnitt B (Südflügel) des Pergamonmuseums am 6. März 2025. Einladung folgt.